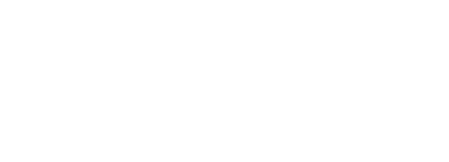Kapitel H
6
Zur ästhetischen Wertung (minimaler) traditioneller Intonationsabweichungen
Einer der erfolgreichsten Kompositionslehrer des 20. Jahrhunderts, der Wiener Komponist Alfred Uhl soll einmal geäußert haben, ein perfekt gestimmtes Musikinstrument könne er beim Komponieren nicht brauchen – es biete ihm zu wenig Herausforderungen für seine Phantasie.
In dieser Äußerung zeigt sich ein besonderer Wert von „nicht völlig exakter Intonation“ für Musikschaffende, aber auch für hörende Menschen. Wird sie als besondere „Würze“ erlebt ?
Im Seminar Mikrotonalität in Wien wurden im Jahr 2007 u.a. Aufnahmen von mikrotonaler und traditioneller Musik analysiert, mit dem Ziel, herauszufinden, ob Mikrotöne gespielt wurden – und wenn, dann welche Mikrotöne jeweils bevorzugt wurden. Dabei bestätigten sich zunächst einige der schon länger erwarteten Differenzen zwischen Notation und Ausführung (betreffend die menschliche Stimme und all jene Instrumente, deren Tonhöhe frei nach dem Gehör variiert wird). Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird später berichtet. Hier wird zunächst die Intonation traditioneller (z.B. „klassischer“) Musik beobachtet.
In der akademischen (europäischen) Musikausbildung geht es unter anderem grundlegend darum, „unrein gespielte“ Intervalle zu vermeiden. Welche der Frequenzen im Einzelnen als „rein“ oder als „unrein“ erlebt wird, das ist teils vom Gehör (auch von dessen Physis) abhängig, teils von Prägungen durch regionale Kulturen, teils vom Stil der zu spielenden Musik, usw. Aber das ändert nichts daran, dass es im professionellen Musikleben sehr stark um ein Vermeiden „unreiner Töne“ geht. Diese sind zu eliminieren, z.B. indem während des Spiels (oder Singens) die Tonhöhe möglichst rasch und unbemerkbar korrigiert werden soll.
Aber wie ist diese Intention zu verstehen ? Als absolute Forderung ?
Zu den gut analysierten und aufgeführten Stücken gehört Hugo Distlers Chormusik. Hier wird von den Chören ausgesprochen rein gesungen. Interessant dabei ist, dass dabei das pythagoreische Tonsystem (die Frequenzverhältnisse resultieren darin aus Kombinationen Primzahlen 2 und 3) meist bevorzugt wird (vor allem gegenüber dem gleichschwebend temperierten). Dies scheint dem Stil der Kompositionen zu entsprechen. Im Schlussakkord von Distlers Chormusik hingegen wird ganz klar die (nicht pythagoreische) Naturterz bevorzugt (4:5),
und auch sie liegt außerhalb der heutigen Klavier-Stimmung.
http://www.soyka-musik.at/upload/media2/Zu%20Mikrobuch%20-%20Terzen%20gro%DF,%20verschiedene.mp3
Diese Beobachtung wirft wieder einige Fragen auf. Hier sollen zunächst nur zwei davon erwähnt werden: Ist der Schluss eines Musikstückes erst erreicht, wenn die Frequenzproportionen von den einfacheren zu den komplexeren Primzahlen fortgeschritten sind ? Oder geht es den Ausführenden um einen „schwebungsfrei reinen“ Schluss (für welchen die - ansonsten ja auch als rein erlebte - pythagoreische Terz 64:81 nicht geeignet wäre) ?
Anhand eines weiteren bekannten Beispiels kann die Fragestellung ausgeweitet werden auf spezifisch mikrotonale Intervalle: Am Anfang von George Gershwins „Rhapsody in blue“ gibt es etliche Akkorde, die musiktheoretisch als Dominantseptakkorde gedeutet werden können (und wurden). Als Septime könnten an sich vor allem die Frequenz-Proportionen 5:9 oder 9:16 oder 4:7 erklingen. Letztere wäre ein ekmelisches Intervall (nach Vogel begründet es die Zukunft der Musik der Naturseptim-Derivate).
http://www.soyka-musik.at/upload/media2/Zu%20Mikrobuch%20-%20XH%205%20Naturseptim-Derivate.mp3
So stellte sich die Frage, welches Intervall hier eigentlich in der Praxis wirklich vom Orchester gespielt wird. Die exakte Nachprüfung erbrachte ein nicht sehr eindeutiges und ein sehr eindeutiges Ergebnis:
Es wurden mehrere verschieden große Septim-Intervalle (also Mikrotöne) gespielt. Jedenfalls wurde hier kein Viertelton intoniert. Auch die reinen klassischen Septimen 5:9 oder 9:16 wurden nicht bevorzugt – eher im Gegenteil: Sämtliche hier gespielten kleinen Septimen waren kleiner (meist sogar deutlich kleiner). Allerdings erklingt auch kaum je die reine Naturseptime 4:7, sondern meist ein minimal größeres Intervall.
Welcher Frequenz-Proportion war nun die reale Intonation am meisten angenähert: Es war in der überwiegenden Zahl der Fälle (und durchaus vom kompositorischen Zusammenhang her erklärbar) die Naturseptime (4:7).
War das von Gershwin intendiert ? Welches Intervall sollte wirklich hier klingen ?
Im Sinne des Jazz gehen in diesem Stück die Ausführenden offenbar davon aus, dass ein „dirty tone“ gemeint ist, und so spielen sie diesen Sept-Ton auch – tiefer als im klassischen Repertoire.
http://www.soyka-musik.at/upload/media2/Zu%20Mikrobuch%20-%20XH%206%20Dirty%20tones.mp3
Aber sie vermeiden (anscheinend sogar gezielt) das Intonieren einer exakten Naturseptime. Dies war für mich die eigentliche Überraschung beim Nachmessen der Intervallgrößen.