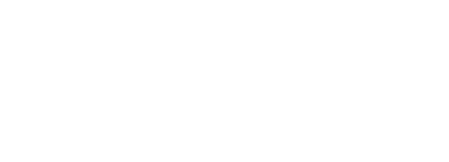Ulf-Diether Soyka
Kompositionspädagogik und musikalischer Stil
Wenn wir unterscheiden zwischen Musik und Nicht-Musik, dann sind wir etwas leichtsinnig. Allerdings bleibt uns als menschlichen Wesen nicht erspart, Unterschiede zu erkennen – da unser Erkennen und Denken nun einmal so beschaffen ist, dass es für das Einordnen von Eigenschaften, Wirkungen usw. „Etwas“ gebraucht, das es von „etwas Anderem“ abgrenzt.
Dieses „Etwas“ (auch wenn es sich um Musik handelt) wird von menschlichen Sinnesorganen aufgenommen und in menschlichen Denkstrukturen verarbeitet. Das heißt, es wird sinnlich niemals vollständig rezipiert (weil jedes Sinnesorgan innerhalb limitierter Frequenzbänder funktioniert). Und dieses „Etwas“ namens „Musik“ wird auch niemals komplett durchdacht (weil dafür unbegrenzte Zeit nötig wäre).
Wenn wir unterscheiden zwischen Musik und Nicht-Musik, dann gehen wir allerdings von wohlbegründeten Tatsachen aus. Dazu gehört z.B. die Unterscheidung zwischen (meist als „musikalisch“ gewertetem) „Klang“ und (viel häufiger als „nichtmusikalisch“ gewertetem) „Geräusch“.
Diese Unterscheidung ist nicht nur eine Erfindung eines Einzelnen, sondern die Unterscheidung zwischen Musik und Nicht-Musik ist in verschiedene Menschengruppen und Kulturen gegeben – auch wenn nicht überall völlig die selben Phänomene als „Nicht-Musik“ gewertet werden. Es gäbe keine Musikgeschichte, wenn Musik nicht als ein unterscheidbares „Etwas“ definiert und in seinen Ausformungen als veränderlich wahrgenommen worden wäre.
Innerhalb der Fülle der Schallereignisse werden somit zwei unterschiedliche Gruppen erlebbar (Geräusche und Klänge), von denen die eine – die Klänge – wieder als in zwei Untergruppen geteilt erlebt werden konnte. Daraus folgt, dass die Unterscheidung zwischen „Wohlklang“ („Konsonanz“ u.ä.) sowie „Missklang“ („Dissonanz“ u.ä.) möglich wurde.
Eine bestimmte naturwissenschaftliche Erkenntnis hat die Unterscheidung zwischen Klang und Geräusch dann sehr erleichtert: Die physikalisch-akustische Beobachtung der Schwingungsvorgänge und Wellen. „Regelmäßige“ Wellenformen bzw. -Kombinationen entsprachen demnach den „Klängen“, und „unregelmäßige“ den „Geräuschen“.
Das Sinnesorgan „Gehör“ (wie immer es nun im einzelnen funktionierte oder aufgebaut sei) wäre nach dieser Lehre imstande zu unterscheiden zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen (periodischen und nicht periodisch geordneten) Schwingungen. Und die Unterscheidung zwischen Klängen und Geräuschen sei physikalisch-wissenschaftlich begründbar. Diese Annahme wurde seit der Verwendung von Oszillaroren durch die Sichtbarkeit von Schwingungs- und Wellenformen zum Allgemeingut für gebildete Menschen. Aber wie haltbar ist diese Unterscheidung eigentlich ?
Und wie haltbar ist die Unterscheidung zwischen „Wohlklang“ und „Missklang“ innerhalb der Klänge ? Wo beginnt die Unordnung, wo endet die Periodizität ? Wie lange Phasen darf die Grundfrequenz haben, um als „periodisch“ bzw. „musikalisch“ erlebbar zu sein ?
Lassen sich auch Unterschiede innerhalb der Gruppe der „Geräusche“ klassifizieren ? Und wenn ja – durch welche Merkmale unterscheiden sie sich ? Mit diesen Fragen beschäftigte sich zunehmend „die Neue Musik“ im 20. Jahrhundert. Wir aber leben im 21. Jahrhundert.
Zusätzlich stellten sich weiterhin alle Fragen innerhalb der „periodischen“ Schwingungen: Wie einfach oder kompliziert darf die periodische Wechselwirkung zwischen Wellen sein ? Müssen alle Wellen von kombinierten Sinuswellen abgeleitet sein, und wie wirken sich Sägezahn- und ähnliche Wellenformen aus ? Ab wann wird eine Kombination von Frequenzen als „dissonant“ erlebt ? Wie lange als „noch konsonant“ ? Gibt es das Empfinden von Konsonanz nur bei rationalen Frequenzverhältnissen (wie z.B. 3:4:5) ? Was geschieht, wenn man höhere Primzahlen einbezieht (4:7 z.B.) – können auch solche Intervalle als „konsonant“ gehört werden ? Gibt es ohnehin keine Unterschiede zwischen Konsonanz und Dissonanz (Schönberg) ? Oder sind die Unterschiede graduell (Hindemith) ? Lässt sich zwischen Konsonanz und Dissonanz nur in bestimmtem Kontext klar unterscheiden (z.B. klassische Musik) ? Können logarithmische Frequenzverhältnisse mit den Potenzierungen der zwölften Wurzel aus 2 prinzipiell nicht zu Konsonanz-Wahrnehmung führen ? Und wenn doch – warum ? Was ist mit Frequenzverhältnissen, die zwar nicht der allgemein bekannten Naturtonreihe (1:2:3:4 ...) folgen, aber doch ganz einfach erklärbar sind wie z.B. 1 : (1+2) : (1+2+3) : (1+2+3+4) usw., oder 1 : (1.2²) : (1.2³.3²) usw ? Was ist mit Frequenzreihen im Verhältnis des „Goldenen Schnitts“, der „Fibonacci-Reihen“ usw. ? Und wie steht es mit den „komplexen Naturtonreihen“, welche den Klang von dreidimensionalen Körpern, wie z.B. von Glocken, Röhren usw. konstituieren ? Klingen sie etwa „dissonant“ - nur weil ihre Teiltöne nicht direkt aus der „Naturtonreihe“ der Saiten- und Blasinstrumente abgeleitet werden können ?
Zudem wird oft nicht ausreichend klargestellt, was mit den Worten "Welle" und "Schwingung" im Einzelnen gemeint ist: Es war ja einleuchtend, wenn Einstein, Planck und andere Physiker die Welt als Teilchen und Welle beschrieben. Und es war – speziell für musikinteressierte Menschen – verführerisch, wenn das Teilchen immer auch Welle sein konnte, wenn eins ins andere verwandelbar schien usw. Es spricht auch vieles dafür, „Musik“ als eine Grundkonstante der Schöpfung zu betrachten – auch wenn irdische Menschen nie ganz imstande wären, alle Details der Schöpfungsordnung zu registrieren oder gar korrekt zu deuten. Auch wo Welle gleich Materie gesetzt werden kann, da kann es „kosmische“ Musik geben, und da kann das menschliche Musizieren als Teil eines viel größeren „Wellensalates“ erlebt werden (z.B. innerhalb der natürlichen Periodik von Tagen, Jahren, Sternenzyklen und physiologischen Rhythmen).
Unterschiedlich sind dann nur noch die Konsequenzen, die aus der teils unerkannten Schwingungsordnung zu ziehen seien: Geht es in der „musica humana“ letztlich darum, die „höheren natürlichen Ordnungen zu erkennen und anzuerkennen“ (auch fürs eigene Leben) ? Oder geht es darum, (mit-)gestaltend in sie einzugreifen ? Welche Eingriffe sind sinnvoll: Nur „harmonisch-periodische“ ? Oder auch „aperiodisch-dissonante“ ? Ist es den Menschen erlaubt, Krach zu machen – und wenn ja, unter welchen Vorbedingungen ? Oder ist der Menschheit geradezu umgekehrt das Ziel gesetzt, „die Unvollständigkeit der Schöpfungsharmonie zu bereichern durch ihre neuartigen Rhythmen und Klänge“ – so dass die Welt erst dadurch vollständig wird ? Stört jede zusätzliche Klangentfaltung ? Ist sie speziellen „Genies“ erlaubt – nicht aber „jedem menschlichen Rind“ ?
Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir das Wort „Welle“ zur Begründung musikalischer Sachverhalte verwenden ? Zunächst war dieses Wort mit der Beobachtung des Wassers verknüpft – weil jahrtausendelang nirgendwo sonst das Phänomen der Wellen ähnlich augenfällig erkennbar wurde.
Wenn man über Komponieren im 21. Jahrhundert nachdenken kann, wird es notwendig, einen bestimmten Zusammenhang ins Auge zu fassen: Den Zusammenhang zwischen „Stehende Weller“ und „musikalischem Stil“. Wenn es um eine neue Epoche geht, dann wird dieser innere Zusammenhang zwischen „Stehender Weller“ und „musikalischem Stil“ wieder einmal wirksam.
Wasser zeigt nämlich nicht nur EINE Form von Welle, sondern es sind ZWEI grundsätzlich verschiedene Phänomene, die mit dem selben Wort bezeichnet wurden ! Und solange Musik als eine Kunst der Schwingungen und Wellen erlebt wird, wird dieser Unterschied in den Grundlagen wirksam sein.
In der musikalischen Akustik ist es der Begriff der „stehenden Welle“ (dessen Definition hier als bekannt vorausgesetzt werden darf), welcher zur Erläuterung musikalischer Phänomene dient: Erst durch ganz bestimmte Überlagerungsmechanismen einer Schwingung mit ihrem „Echo“ bzw. mit Teilschwingungen - also durch ganz bestimmte Bedingungen im Bereich der Schwingungen selbst - kommt es zu „periodischen Schwingungen“, zu „stehenden Wellen“ usw. Diese auch physikalisch erkennbaren Phänomene korrespondieren zu akustisch wahrnehmbaren Phänomenen als „Klang“ (oder bei ihrem Ausbleiben: Als „Geräusch“). Genau diese Phänomene zeigen sich schon bei der Wasserwelle. Aber:
Sie zeigen sich unterschiedlich (!), je nachdem ob es sich um die Welle in einem Fluss oder um die Welle in einem See handelt. Dieser Unterschied muss hier kurz erläutert werden:
Die Welle im See entsteht daraus, dass die schwingenden Kleinteilchen sich bewegen – hin und her, vor allem auf und ab. Das einzelne Molekül usw. bleibt dabei auf Dauer „an seinem Platz“ (wenn es sich um einen „idealen“ See handelt, ohne Sturm, ohne Zu- oder Abfluss, bei stets gleichbleibender Wassermenge). Das einzelne molekulare Teilchen weicht zwar von diesem seinem Platz fort - innerhalb gewisser Wellen-Frequenzen, innerhalb von Wellenbergen und Wellentälern, hin und her: Aber im Mittelwert bleibt das materielle Teilchen, wo es ist. Die Welle (!) selbst aber (die optisch sichtbare Form mit ihren „Bergen“ und „Tälern“) „wandert“ weiter. Für das Auge der Betrachtenden sieht es so aus, als würden die Wellen „sich ausbreiten“ (z.B. wenn man einen Stein in den See geworfen hat): Die einzelnen atomaren, materiellen Teilchen bleiben wo sie sind – die Welle wandert weiter.
Und das ist der prinzipielle Unterschied zur Welle in einem Fluss. Im strömenden Wasser kommen stets neue materiellen Teilchen von oben und fließen nach unten weiter. Natürlich entstehen auch hier die Wellen (ebenso wie im See) durch ein Hin-und-her der einzelnen materiellen Teilchen, z.B. im Rahmen des Flusses. Aber für das Auge der Betrachtenden bleibt (beim ebenso „idealen Fluss“) der Wellenberg dort wo er war (z.B. über Stromschnellen), und das Wellental bleibt, wo es war. Die Wellenform bleibt wo sie ist – die materiellen Teilchen wandern abwärts weiter.
Einstein hatte u.a. zu ringen mit der Frage, ob bzw. wie die Lichtwellen sich innerhalb eines von materiellen Teilchen angefüllten Universums ausbreiten. Eine Frage Einsteins war, was sich für die Lichtwellen änderte, wenn diese materiellen Teilchen nicht ruhten (wie in einem See), sondern sich fortbewegten (wie in einem Fluss oder in einem „sich expandierenden See“). Auf die weiteren Fragen und die Antworten Einsteins brauchen Musikschaffende jetzt nicht im Detail einzugehen (z.B. auf die Annahmen eines „teilchenleeren“ Raumes, in dem Licht sich als „Welle“ dennoch ausbreiten könne). ... .... ..... DER VOLLSTÄNDIGE ARTIKEL KANN BESTELLT WERDEN UNTER ud ( at ) soyka-musik.at