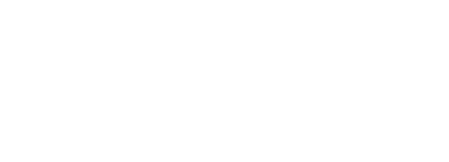Ulf-Diether Soyka
Wie (in)tolerant wirken Schönheitsbegriffe ?
publiziert in der Zeitschrift "Literatur aus Österreich",
Heft 239, Jahrgang 40, Dezember 1995, unter dem Titel
"Versuch über das Gutewahreschöne"
Fünfzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist es wieder notwendig über die Wechselwirkung von Toleranz und Schönheitsbegriffen nachzudenken. Angesichts verschiedener Entwicklungen gilt es jetzt sogar, grundlegende Unterschiede rechtzeitig zu klären.
Das jahrzehntelange Schweigen über Schönheitsbegriffe (nur die Seifenreklame machte da eine Ausnahme) war wohl begründet durch Scham angesichts der Tragödien, die im 3. Reich durch dessen ästhetische Wert- und Zielvorstellungen ausgelöst worden waren ("blond ist schöner als..!" etc.). Aber durch dieses Schweigen wurden Worte wie »Schönheit", »schön« usw. zu Tabus für eine neue Generation kulturell Interessierter. Damit wurde verhindert, daß demokratische Zugänge zum Thema »Schönheit« in einer verantwortbaren Art gefunden worden wären. Wie tolerant kann das literarische (und das musikalische) Österreich mit Schönheitsbegriffen umgehen? Bleibt das Wort »schön« wieder dem Einsatz für totalitäre Zwecke vorbehalten?
In der qualifizierten österreichischen Kulturdiskussion der Nachkriegszeit war nicht nur das Wort »Schönheit« ausgeklammert: z. B. über die Qualität neuer Musik wurde mittels anderer Maßstäbe entschieden. Dabei schien lange Zeit dem nachrechenbaren Materialdenken serieller Konzepte der Vorrang eingeräumt. Arnold Schönbergs Zwölf-Ton-Methode auszuweiten, bot die nötige Garantie, alte Fehlentscheidungen vermeiden zu üben (obwohl Schönberg selbst - Ironie der Geschichte - dadurch die »Vorherrschaft deutscher Musik für hundert Jahre sichern« wollte).
Aber spätestens mit der »Neuen Einfachheit", der »Minimal Music« und der »Postmoderne« zeigte sich, daß ein Stil-Pluralismus nicht mathematisch kontrolliert werden kann. Im Avantgarde-Zentrum Darmstadt wurde ab Ende der 1970er-Jahre Ernst Krenek zitiert, der die Zuwendung zu serieller Musik für nicht geschichtsnotwendig, sondern für subjektiv erklärte. Andere Kriterien zur Bewertung von Qualität wurden vorgeschlagen. In der neuen Musik wurde (statt nach Publikum für neue Musik) - mehr oder weniger offen - nach »schöner neuer Musik« gesucht.
Jörg Mauthes und Günther Nennings »Schönheits-Manifest" zeigte das Dilemma speziell für den Bereich der Baukunst auf: Im Manifest selbst kommt das Wort »häßlich« wesentlich häufiger vor als das Wort »schön« bzw. »Schönheit": Der Versuch einer Neubewertung von Schönheitsbegriffen war durch diese Polemik sofort in Gefahr, wieder zweckentfremdet zu werden.
Während Mauthe und Nenning nämlich selbst den Mut hatten, persönliche (unterschiedliche, teils tragische) Konsequenzen für ihre Entscheidungen zu tragen, wurde mit dem "wiedergefundenen« Schönheitsbegriff von anderen Autoren einer an sich überlebten Generation bald wieder (zumindest) ungeschickt bis fahrlässig hantiert - was rasch zu national gefärbten Auseinandersetzungen beitrug. International führende Künstler fühlten sich daraufhin in ihrer Freiheit gefährdet durch allzu eilige Werturteile.
Der Komponist Helmut Lachenmann z. B. meinte 1982: »Schönheit, das ist das Ruhekissen oder Nadelkissen jener Gattung Mensch, welche niemals davon hat ablassen können, im Namen der Liebe zu hassen, im Namen der Wahrheit zu lügen, im Namen des Dienens zu verdienen, im Namen der Fürsorge auszubeuten, im Namen des Lebens zu töten, im Namen der Freiheit zu unterdrücken und im Namen der Verantwortung sich dumm zu stellen."
Bei aller Betroffenheit, die seine Definition auslöste, wurde ihm damals in den »Wiener Sommerseminaren für neue Musik« entgegnet, daß eine Alternative zur Suche nach »schöner neuer Musik« wohl nur wäre, sich auf museal-technologische Absicherung zu beschränken: »Wozu noch teure Orchester und Chöre erhalten, bringt doch der Music-Computer (zumindest?) die gleiche Leistung.« Schon Gottfried von Einem hatte frühzeitig auf »seelischen Skorbut" durch Tonträger hingewiesen, und György Ligeti hatte sich (aufgrund der Klangqualität) schließlich wieder für traditionelle Instrumente entschieden.
Die Diskussion nahm bedrohliches Ausmaß an, sobald etliche der Beteiligten begannen, den Schönheitsbegriff so zu verwenden, als wäre DIE »Schönheit« ein eindeutig abgrenzbares (und womöglich käufliches) Ding, über das willkürlich verfügt werden könnte (»schöne neue Musik ist tonal« usw.). Restriktive Folgen wurden befürchtet, totalitäre Vereinnahmung der Kunst und neue Zensurmaßnahmen wurden ebenso unterstellt wie Tendenzen zu »Reichs-Schönheitskammern« u. ä. Der "lang vermiedene Kulturkampf" schien in Österreich ausgebrochen zu sein. In der Ernsten Musikszene waren diese Differenzen zwar eigentlich durch ein Defizit an einer angemessenen Musiktheorie der Gegenwart verursacht (weder Folgen des Jazz, noch der Elektroakustik, noch soziologische Implikationen sind bisher ins Lehrgebäude sprachlich einbezogen worden), aber diverse Literaten nützten die unklare Situation sehr rasch für neue Polemiken aus. Und politische Parteien sahen ihre Chance in kulturellen Stellvertreterkriegen.
Nicht zuletzt durch diese Auseinandersetzungen wurde die gesetzliche Festschreibung der »Freiheit der Kunst« in Osterreich beschleunigt. Diese - an sich durchaus zweischneidige - Rechtsschöpfung hat seither Eigenleben entwickelt.
Doch zunächst zurück zur Aporie der Schönheitsbegriffe. »Es ist dem Menschen gegeben, Schönheit gültig zu erfassen" versus »Schönheit ist für den Menschen letztlich unfaßbar" - beide Sätze sind (laut Ansicht je unterschiedlicher Gruppen) wahr. Beide Sätze handeln vom selben Inhalt, beide sind voneinander nicht zu trennen, und beide widersprechen einander.
Der erste Ast dieser Aporie - der Schönheit gültig erfassen zu können meint - begründet den Versuch, »Schönes" zu kommunizieren, ebenso wie den, »Unschönes" (etc.) auszugrenzen, oder den Versuch, »Schönes" zu finden bzw. zu schaffen. Er begründet die Dominanz der »Genies" über den Geschmack des »Publikums". Hier fallen Entscheidungen darüber, welche kulturellen Werke es »wert" seien, erhalten (und finanziert) zu werden, welche Künstler ihre »Arbeit tun dürfen" (und welche nicht), und offen ist hier höchstens die Frage, wer denn die Entscheidung darüber zu treffen habe.
Der zweite Ast - der Schönheit letztlich in einem transzendenten Reich der ungreifbaren Ideen ansiedelt - begründet die endlose Fortsetzung der (stets hinfälligen) Suche nach »Schönem" (obwohl doch »eh g`nug da« wäre) und relativiert die Maßstäbe, nach denen wir ästhetisch werten. Er begründet die »Demokratie" der Hitparaden wie die Mehrheitsentscheide der subventionsempfehlenden Fachbeiräte. Hier gibt es eine »offene Skala" der Wertungen, grenzenlos offen nach oben (es könnte ja immer »noch Schöneres« auftauchen) und offen zum Nachbarn (dessen Stil ja ebenfalls »Schönheit" zulasse, auf dessen Art eben).
Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Schönheitsbegriffen: Während die erste grundsätzlich als »geschlossen", als »definierend" bezeichnet werden kann, ist die zweite nicht dazu bestimmt, daß Künstler ihre eigenen Werke selbst als »schön", ihren Stil als »Schönheit" anpreisen (und dabei letztlich die Bedeutungsinhalte des Wortes »Schönheit" einengen). Offene Schönheitsbegriffe (im zweiten Ast der Aporie) sind auch nicht dazu bestimmt, anderen Menschen Vorschriften darüber zu machen, was sie als »schön" zu empfinden und zu werten hätten. Sondern offene Schönheitsbegriffe können eine (freiwillige) eventuell gemeinsame Suche nach (subjektiv) als »schön" Erlebbarem anregen. Allerdings ist auch der zweite Ast der Schönheits-Aporie nicht unproblematisch: Nur einen Ast dieser Aporie anzusprechen, bedeutet nämlich, auch den zweiten mit wachzurufen. Das Wort »Schönheit" zu thematisieren, verlangt folglich unvermeidbar auch, Äußerungen der Intoleranz zu tolerieren. Eine offene »Schönheits"-Diskussion kann ohne subjektive Wertungen ebensowenig geführt werden wie ohne intersubjektive Kommunikation, ohne Offenheit ebensowenig wie ohne Toleranz.
Die Unterscheidung (und Auseinandersetzung) zwischen »geschlossenen" und »offenen" Schönheitsbegriffen bliebe eine rein theoretische, würden aus der Beantwortung der Fragen nicht auch zugleich immer Vorrechte für bestimmte Menschengruppen abgeleitet. Da beginnt das Reich des Mißbrauchs von Ideen zu blühen, und so zeigt sich die Berechtigung der Warnungen Lachenmanns. In dem Moment, wo eine Kunstform beginnt, sich selbst als DIE "schöne" zu bezeichnen, ähnelt sie einer Frau, die sich selbst als "schöne Frau" präsentiert - die Motive werden durchsichtig, Polemik gegen Anderes beginnt die eigentliche Schönheitssuche zu ersetzen, Geschäft und Macht versuchen Zensurprozesse auszulösen (heute meist durch Uber-Information).
Besonders heikel wird die »Schönheits"-Polemik aber in einer Gesellschaft, die die »Freiheit der Kunst" gesetzlich schützt: Ist plötzlich die Funktion des »Genies" geschützt? Steht die Freiheit zu »schönen Menschenexperimenten" über den übrigen Menschenrechten der »unschönen Masse"? Wie läßt sich die künstlerische Versuchung zu »schönen Vergewaltigungen« eingrenzen? Stehen nun Künstler vor dem selben Dilemma wie die (ebenfalls in ihrer fachlichen Freiheit geschützten) Physiker? Wie weit hat die Toleranz der »schön Beglückten" zu gehen?
Die Büchse der Pandora läßt sich nicht schließen: Wie ließe sich Mißbrauch verhindern? Durch Verzicht auf DIE »Schönheit"? Oder durch Verzicht auf »Schönes"? Etwa gar durch Verzicht auf Schönheits-Suche und Sehnsucht?
Die Auseinandersetzung der 1990er-Jahre wurde zum Glück vorsichtiger geführt. Zwar gibt es wieder sektiererische Gruppen, die mit »ästhetischer" Polemik operieren (,Henker unserer Kultur", ,zeitgenössische Sklavenhalter", »verdeckte Bereiche", »totalitäre Vorrangstellung", »Rufmord", »Kulturkampf" usw.). Solange das Bildungsniveau hält, und solange die Kulturbudgets ausreichend hoch dotiert sind, erhalten solche Tendenzen allerdings wenig Zustimmung.
Einen möglichen Schutz vor dem Machtanspruch solcher Sektierer zeigt der neue Weltkatechismus der katholischen Kirche: »Die Wahrheit ist von sich aus schön« wobei vom christlichen Wahrheitsbegriff ausgegangen wird (Jesus als die Wahrheit, der Weg und das Leben). Das Mysterium der Schönheit als »Abglanz« unsichtbarer Herrlichkeit Gottes stellt - so gesehen - einen Ausweg aus dem Dilemma dar, indem hier beiden aporetischen Asten ihre relative Funktion zuerkannt wird. Wer richten will, hat dafür also den höchsten irdischen Preis zu zahlen.
Gefährlich allerdings wirken verkürzte Darstellungen dieses Katechismus. Wenn z. B. die Versuchung steigt, die Definition umzukehren, zu behaupten, etwas sei bereits »wahr, weil es ja schön" sei, dann sind damit künftige Auseinandersetzungen angedeutet. Denn z. B. das Kriterium gentechnischer Reparaturen kann ja nicht in mathematischer Richtigkeit des Ergebnisses liegen, sondern eher in dessen »Schönheit« - und hier ähnelt die technologische Diskussion jener im Musikleben vor wenigen Jahren. Es kann vermutet werden, daß die neue Gen-Kosmetik sich viel eher auf die »Freiheit der Kunst« berufen mag als auf die »Freiheit der Wissenschaft«. Wie wahr wird DAS »Schöne« aber dann sein? Und wieviel Toleranz werden wir in der Folge aufzubringen haben? Was brächte eine Verteilung, die den einen DIE »Schönheit den anderen DIE Toleranz zuwiese bzw. abverlangte? Es stellt sich hier die Frage, welche Rolle den Literaten in diesen höchst aktuellen Entwicklungen zukommen wird. Werden sie sich entscheiden für eine (womöglich definierende) Beschreibung erwünschter »Schönheit"? Werden sie sich auf die Seite der Schwächeren (und damit teilweise gegen die "Freiheit" gen-chirurgischer und anderer Künste) stellen? Werden sie sich mit der Rolle begnügen können, Anregungen zu geben? Werden sie Wertungen durchzusetzen helfen? Werden sie ihre Rolle im Markt rechtzeitig bemerken? Genügen Aufrufe zur Toleranz demnächst noch? Oder müßten diese kontraproduktiv wirken?
Gleichgültig, was im Detail nun als DAS »Schöne" bezeichnet wird: In jedem Fall beansprucht es besondere Zuwendung und Zuwendungen. Wurden diese so nicht gleich erzielt, dann wurde noch stets die Schuldfrage gestellt. Damit war stets das Feindbild eine direkte Folge und Begleitung DES »Schönen". Der Aufruf zur Intoleranz konnte ohne Berufung auf DAS »Schöne" niemals »begründet" werden. Wer nämlich fühlt, wie auch andere Menschen, auch Konkurrenten, selbst Schönes erahnen, der/die kann sie ja nicht so leicht verachten.
So gesehen ist ein Denkansatz interessant, welcher davon ausgeht, schön sei es, die Macht abzugeben. Schön sei es, wahrhaft freiwillig zu dienen. Schön sei es, Gott und den Nächsten zu lieben. Schön sei es, für die kommende Welt zu sorgen. Schönes im Unschönen aufzuspüren, sei Kunst. Nicht DIE (fertige) »Schönheit« sei das Wesentliche, sondern so etwas wie eine künftige, transzendente, unvorstellbare, höhere Schönheit, die mit menschlichen Mitteln (jetzt noch) nicht zu fassen wäre - die unbezahlbare (und daher unbezahlte) Schönheit, die sich niemals selbst als solche bezeichnen (lassen) würde. Und künstlerische Vorrechte wären vor allem Vor-Verpflichtungen.
Aber auch diese Vermutungen zu äußern, kann schon wieder kontraproduktiv wirken. Das wertende Wort sollte anderen überlassen bleiben, die damit wahrhaft umgehen könnten.
Es kann nämlich nicht die Rolle schaffender Künstler sein, gleichzeitig das Ausmaß DER »Schönheit" zu werten. Würden Künstler sich ernsthaft in diese Rolle drängen lassen, dann würden sie Sprintern gleichen, die rasch zu laufen versuchen während sie gleichzeitig auf die Stoppuhr gucken, um Rekorde zu registrieren. Das ginge nicht gut. Schaffen und Werten ist ein Widerspruch in sich. Künstler zu Hirten zu bestellen, hieße Böcke zu Gärtnern zu machen.
Wer also soll die Geister unterscheiden? Wir haben gewiß kein Recht, auf Gottes weitem Feld dasjenige auszurotten, was wir für »Unkraut« halten. Oft ist doch gerade das Abgelehnte ein Heilkraut und letztmögliche Hilfe in der Krankheit. Schönheit kann so rasch verblühen - auf die Früchte zu warten, ist meist klüger. Lassen wir die kommende Welt werten: Der Erfolg kommt, sobald wir ihn nicht mehr brauchen. Das alte römische Wort »Toleranz" ist zwar ebenso mißverständlich wie das Wort »Schönheit" - aber eben deshalb können diese beiden Worte ein nettes Paar bilden.