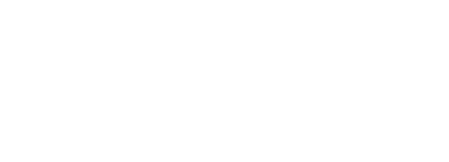soyka_dirigiert_soyka_streichorchester.MP3
soyka_dirigiert_soyka_streichorchester.MP3
soyka_dirigiert_soyka_terpsichore.MP3
soyka_dirigiert_soyka_terpsichore.MP3
Ulf-Diether Soyka SYMPHONIE Nr. 1 1. Satz (Ausschnitt) Symphonieorchester Pazardhik Dirigent Grigor Palikarov
UD Soyka 1. Symphonie 1.Satz Teil.mp3
Ulf-Diether Soyka 2. VIOLINKONZERT 1. Satz (Mitte) Elena Denisova (Violine) Symphonieorchester Pazardhik Dirigent: Grigor Palikarov
UD Soyka 2. Violinkonzert 1. Satz Mitte.mp3
Ulf-Diether Soyka 2. VIOLINKONZERT 2. Satz (Ende) Elena Denisova (Violine) Symphonieorchester Pazardhik Dirigent: Grigor Palikarov
UD Soyka 2. Violinkonzert 2. Satz Ende.mp3
Ulf-Diether Soyka 2. VIOLINKONZERT 3. Satz (Anfang) Elena Denisova (Violine) Symphonieorchester Pazardhik Dirigent: Grigor Palikarov
UD Soyka 2. Violinkonzert 3. Satz Anfang.mp3
Ulf-Diether Soyka KLAVIERKONZERT, 2.Satz (Anfang) Jeong Won Kim (Klavier) Symphonieorchester Szombathely Dirigent: Ulf-Diether Soyka
UD Soyka Klavierkonzert 2. Satz Anfang.mp3
Ulf-Diether Soyka: Sinfonie Nr. 3 ("Die Unspielbare"), 4 Sätze
https://www.qobuz.com/ch-de/album/sinfonie-nr-3-in-yes-dur-opus-10-10-die-unspielbare-ulf-diether-soyka/e4xd5347hbxpa
Ulf-Diether Soyka
Sinfonie Nr. 3 in Yes-Dur opus 10/10
„Die Unspielbare“
1 dramatisch
2 melancholisch
3 Scherzo, tänzerisch
4 Rondo, rasch
Komponiert mit finanzieller Unterstützung durch das
Österreichische Bundeskanzleramt / Kunst und Kultur
Sowie das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Digital aufgenommen an der
Enharmonischen Mikroton-Orgel von Hans-André Stamm
im Prayner-Konservatorium Wien,
sowie mit Minimuse, der mikrointervallischen
U-Plex-Spezialtastatur von Andrew Aaron Hunt.
In dieser Komposition gibt es vier
verschieden hohe Töne „Es“ (Es, Xes, Yes und Wes),
sowie jede weitere „chromatische“ Tonhöhe
in vier verschieden hohen Varianten.
Dadurch können Tonsysteme alter Musik-Hochkulturen
(Slendro, Maqam, Shrutis, Blue-Notes u.v.a.)
in den Tonsatz und die Melodik einbezogen werden.
Ulf-Diether Soyka, geb. 1954 in Wien,
ist Komponist, Dirigent und Dozent für Musiktheorie.
Er komponierte Opern, Oratorien, Sinfonien, Instrumentalkonzerte,
Chor- und Kammermusik.
Weitere Informationen bei www.soyka-musik.at
CD-Cover 2019
Was passiert, wenn es immer mehr Töne gibt, wenn die Abstände zwischen den Tonhöhen immer kleiner werden, wenn ganz neue Zwischentöne dadurch möglich und wirksam werden ? Was für Melodien und Zusammenklänge entstehen da ?
Das ist vielleicht die schrägste Musik, die ich mir vorstellen kann - sie "erzählt" von teils entsetzlichen, teils himmlischen, teils scherzhaft-selbstironischen Phasen, bis hin zu einem eigentlich unfassbar harmonischen Ende.
Ulf-Diether Soyka Januar 2020
Arbeitsbericht und Andeutungen zum Tonsatz der Sinfonie Nr. 3 in Yes-Dur opus 10/10 („Die Unspielbare“), sowie Hinweise zu daraus resultierenden Optionen und Fragen:
Beim Kennenlernen dieser Sinfonie gilt es, zwei unterschiedliche Grundlagen dieser Musik zu unterscheiden:
Einerseits basiert die Komposition darauf, dass innerhalb einer viel größeren Fülle von Tonhöhen ausgewählt und kombiniert werden konnte, und dass diese vorrätigen Tonhöhen viel kleinere Abstände von einander haben als in klassischer europäischer Musik. Daraus ergibt sich eine enorme Fülle neuartiger Möglichkeiten - z.B. „fremd“ wirkende, „unrein“ scheinende, „futuristische“, aber auch (durch die differenziertere Exaktheit ) „viel reiner“ wirkende „traditionelle“ Tonkombinationen.
Die Frage, wie im Detail da welche der minimal unterschiedlichen Tonhöhen nun mit anderen Tonhöhen aus dem erweiterten Vorrat zusammenwirken könnten, führte zur Notwendigkeit, sich mit der Lehre vom Tonsatz nochmals völlig neu zu befassen. Erst nachdem hier geeignete, musiktheoretisch logische und praktisch anwendbare Modelle gefunden worden waren, konnte ich mit dieser Fülle der Tonhöhen gezielt arbeiten. In diesem Tonsatz zeigt sich die „objektive“ Neuerung, eine abstrakt-theoretische Grundlage der Sinfonie – eine Basis, die für sämtliche KomponistInnen der Welt gleichermaßen verfügbar sein kann, wenn sie dies wollen, mit deren Hilfe sie auch komplett andere Ergebnisse erzielen könnten als ich.
Andererseits aber beruht diese Komposition darauf, dass ich Tonkombinationen ausgewählt habe, anhand meiner subjektiven Klangfantasie, meiner psychischen Situation, meiner ästhetischen Vorliebe, meiner künstlerischen Absichten usw. – dass ich dabei Empfindungen erlebt und Assoziationen erzeugt habe, die von anderen Menschen zwar geteilt werden können, aber für sie nicht passen müssen (schon gar nicht für alle Menschen gleichartig).
Ich bitte, dass diese beiden ganz unterschiedlichen Grundlagen der vorliegenden Aufnahme ausdrücklich im Bewusstsein behalten werden.
Wenn darüber hinaus dann zusätzlich auch über die Notation und Aufnahmetechnik, sowie über potentielle physische Aufführungsmöglichkeiten detailliert nachgedacht wird, kann dies hilfreich für die nächsten Entwicklungsschritte im Musikleben wirken.
Die rein digital mit gesampelten Instrumentenklängen hergestellte Tonträgeraufnahme kann eine Entscheidungshilfe bieten für potentielle Musikveranstalter, Verlage, DirigentInnen usw. – darüber hinaus kann sie für interessierte InstrumentalistInnen eine Hilfe sein zum Kennenlernen der Komposition, und ggf. zum Lesen der Noten und zum Üben für eine doch irgendwann denkbare instrumentale Ausführung im Konzertsaal oder wo auch immer.
Es gibt u.a. noch die Dateien, in denen z.B. das Tempo der einzelnen Musikstellen geändert werden kann - wenn z.B. OrchestermusikerInnen wissen wollen, ob sie die notierten Tonhöhen exakt genug bewältigt haben.
Am hilfreichsten für die Zukunft erscheint mir jedenfalls das kritische und selbstkritische Hören dieser Kompositionsweise, die so unendlich viele neue Möglichkeiten in sich birgt. Damit zum Arbeitsbericht:
Seit 2013/14 bekam ich Gelegenheit, kompositorisch an einem meiner Lebensziele zu arbeiten - und nach Jahren mühseliger Kleinarbeit konnte ich 2019 endlich meine dritte Sinfonie fertigstellen, mit finanzieller Hilfe der Kulturabteilung der Niederösterreichischen Landesregierung und des Österreichischen Bundeskanzleramts.
Als ich 1982 das Ensemble „Harmonia nova“ gründete, war es gleich in den ersten Konzertenein zentrales Anliegen von mir, dabei Musik aus uralten Musik-Hochkulturen der Welt und Historie kompositorisch zu verbinden mit musiktheoretischer und avantgardistischer Forschung – japanische Gagaku-Musik, indische Shrutis, orientalische Maqams, ostasiatische Slendros, afrikanische Blue-Notes, altgriechische Enharmonik, georgische oder bulgarische Septimensätze, terzenreine, pythagoreische, mitteltönige, gleichstufig temperierte, chromatische Zwölftonmusik, enharmonische, ekmelische Mikrointervalle, Glissandi, emotionelle Zwischentöne u.ä.
Ich kannte damals eine Schallplattensammlung unterschiedlichster Musiktraditionen weltweit, die mich ab ca. 1970 auf die Frage gebracht hat, was da wohl ein (musiktheoretisch, ev. kompositorisch) Verbindendes sein könnte. Die CD-Ausgabe dieser historischen Aufnahmen findet heute sich bei: https://ich.unesco.org/en/collection-of-traditional-music-00123 . Darin zeigt sich ein Hinweis auf ein treibendes Motiv für meine gesamte Noten-Arbeit seither.
Mehrere unterschiedliche Harmonie-Systeme - Flageolett-Töne, Glocken-Teiltöne, Gong-Akkorde, Alban Bergs Zwölftonkadenz, Hindemiths Satzlehre, Messiaens Jazz-Skalen (in just-intonation) – waren dann Ausgangspunkte für die Suche nach einer gemeinsamen tonsetzerischen Basis für immer größere Bewegungsfreiheit der Melodien in ihrem harmonischen Zusammenhang.
Hans-André Stamms Enharmonische Mikrotonorgel mit ihrer speziellen Tastatur von Martin Vogel (48 Tonhöhen pro Oktave) bot mir endlich ab 2006 eine erste Möglichkeit, Aufnahmen der gemeinten Musik exakt genug herzustellen.
Durch diese Tastatur ergab sich einerseits eine Möglichkeit, die Tonfolgen hörend zu üben, anderseits aber auch die Möglichkeit, dass hörende Mitmenschen ihre konkreten Einrücke und Gefühle beschreiben, z.B. mit Angabe der jeweiligen Minute im Musikstück. Ich finde das Kennen von HörerInnen-Reaktion enorm wichtig, weil ich zwar die Gefühle kenne, die ich selber beim Hören habe, aber ich brauche zu zwei Punkten das Echo mitdenkender und mitfühlender Menschen: Zur erweiterten Tonsatz-Methodik bzw. Musiktheorie seitens der FachkollegInnen, und zur subjektiv auswählend notierten Konkretisierung in der jeweiligen Komposition seitens des „Publikums“.
Daher bevorzuge ich eine exakte Unterscheidung zwischen den neuen Tonsatz-Optionen einerseits - und andererseits meiner subjektiven Anwendung und Auswahl von Tonkombinationen innerhalb der möglichen Anordnungen von Zwischentönen, also zu dem Eindruck, den meine spezielle Anwendung dieser Möglichkeiten in speziell dieser einen Komposition auf andere Menschen ausübt: Hinweise auf deren subjektiv gefühlsmäßige Eindrücke nämlich.
Gerade die hörende Reaktion von Menschen zu kennen, die sich kompositorisch nicht(!) erklären können, wie das klingende Ergebnis zustande kommt, finde ich besonders wichtig. Ob das Echo in ganz unterschiedlichen Menschengruppen (Disco-Besucherinnen, klassische Konzertliebhaber, Komponistenkolleginnen, Jugendliche, Schüler, sogar Kleinkinder usw.). unterschiedlich ist, halte ich für höchst wissenswert für den Komponisten. Ich sehe diese Kenntnis (Selbstkenntnis) als Teil meiner selbstkritischen Verantwortung. Denn ich verfechte nicht diese oder andere Musik - ich will neue Wege öffnen, die sich verantworten lassen.
Enharmonische Mikroton-Orgel des Komponisten Hans-André Stamm (1979) in Wien
Tastatur: Univ. Prof. Martin Vogel, Bonn (1968) in : Die Zukunft der Musik.
Hunderten von digitalisierten Mikrotonskalen (avantgardistische Forschung und aus musikalischen Hochkulturen der Welt), durch wurden Andrew Aaron Hunt digital hörbar gemacht.
Ene enorm praktikable Erweiterung meiner Aufnahme-Möglichkeiten bekam ich vor einigen Jahren dann durch die U-Plex-Tastatur von Adrew Aaron Hunt: Ich nenne das Instrument seither „Minimuse“, weil dadurch eine so feine Differenzierung der Zwischentöne notierbar und hörbar wird:
U-Plex / Minimuse: Tastatur von Andrew Aaron Hunt (USA ca. 2000)
Es gibt in der 3.Sinfonie (wie an Stamms Tastatur) „jede Tonhöhe vierfach“ - z.B. den Ton „Wes“, „Xes“, „Yes“ und „Es“ (jeder ist eine mikrointervallische Tonhöhen-Variante „des einen traditionellen Tons Es“), und dazu teils auch Vierteltöne („zwischen Es und E“ bzw. zwischen anderen chromatischen Halbtönen): Ob ein traditionelles Intervall nun konsonant oder dissonant ist, hängt davon ab, welches der Mikro-Intervalle im Einzelnen verwendet wird. So kann sogar die „Oktave“ zwischen „Wes 1“ und „Yes 2“ z.B. eine Dissonanz sein.
In den vergangenen Jahren habe ich damit experimentiert, und spannende Zusammenhänge und Wechselwirkungen hörend herausgefunden. Für die dritte Sinfonie habe ich jede einzelne Note mindestens zehnmal extra aufgenommen, in ihrer Klangfarbe, Lautstärke und Tondauer eigens korrigiert, die Melodien zusammengesetzt – und so zu einem Ergebnis gefunden, wie es „schräger“ kaum möglich sein könnte. Eine derartige Bandbreite von harmonischestem Wohlklang bis zu extremster Reibung zwischen den Tonhöhen konnte ich mir bis dahin nur im Kopf vorstellen – niemand hat bisher die nötige Gehörbildung absolviert, um solche Musik live im Konzert aufzuführen.
Noch dazu, wo ich so viele „exotische“ Instrumente im Orchester zusätzlich eingesetzt habe – Bansuris, Ney, Duduk, Shehnai, Tulum, Kalimba, Kaval, Gongs, Kora, Tanpura, Oud u.v.a.
Bansuri
Ney, Nay, Nej. Duduk, Shehnai, Tulum, Kalimba, Kaval, Tuned Gongs Kora, Oud, Tanpura,Uilleann Pipes, Highland Pipes.
Daher trägt die Sinfonie Nr. 3 opus 10/10 in Yes-Dur den Beinamen „Die Unspielbare“.
Beispiel dafür, wie „ein- und derselbe“ Akkord unterschiedlich wirkt, sobald die chromatischen Möglichkeiten in just-intonation ausgeweitet – und mikrotonal – werden, habe ich in musiktheoretischen Publikationen vorgeführt.
Die Sinfonie hat vier Sätze (vergleichbar den vier Temperamenten, Aggregatzuständen u.ä.): Einen dramatischen, einen melancholisch-mystischen, ein Scherzo und ein märchenhaft rasches Rondo. Die Musik ist voll von überraschendem Stimmungswechsel zwischen europäischen und fremden Tonsprachen, voll von Witz und Selbstironie.
Die in den „Zwischentönen“ entdeckte „erweiterte musikalische Grammatik“ ermöglicht ein Darstellen von Aporien, akustischen Täuschungen und Brechungen, Sprachenwechsel, von Als-Ob und Missverständnissen, mit einem z.B. raschen oder verzögerten Perspektiven- und Paradigmenwechsel, aber auch in Mehrperspektivität, sie bringt irreale Hypothesen und futuristische Konjunktive bis hin zum modernsten Etikettenschwindel. Damit eignet sie sich sehr für das Entwickeln tragischer, zynischer, sarkastischer und komischer Momente.
In meiner Studienzeit bei Friedrich Cerha an der Wiener Musik-Universität träumte ich schon in meiner ersten Komposition von solchen fantastischen Möglichkeiten. Heute bin ich unendlich erleichtert, dass es mir wirklich noch vergönnt ist, an dieser hochsensiblen musikalischen Zukunftsentwicklung mitzuwirken.
Wo neue Optionen entstehen, sind auch spannende Fragen neu durchzudenken:
Z.B. zum Urheberrecht: Wem „gehört“ etwa „der Anfang des Donauwalzers“, wenn ich den zweiten Melodieton (traditionell der „Terzton“) „um ¼-Ton zu hoch“ bringe ? Oder als „neutrale Terz“ („zwischen Dur und Moll“) ? Sollte ich für diese Komposition z.B. auf Tantiemen verzichten ?
Eröffnen sich hier ganz neue Arbeitsfelder und Herausforderungen für das Urheberrecht ?
Was passiert im Konzertsaal, wenn ich die „orientalische“ neutrale Terz begleite mit „alpenländischen“ Jodler-Dreiklängen ?
Oder wenn ich ehrwürdige heilige Melodien fremder Musiktraditionen scheinbar durcheinander abwandle oder kombiniere ?
Wie diese Musik auf mich selber wirkt, merke ich - aber auf andere Menschen ?
Oder ist das Ergebnis eher Audiokunst statt Musik zu nennen ?
Und der nächste Schritt ? Interkulturell-interreligiöse Komposition ? Inkulturation, Integration oder Inklusion ? Mit Texten in z.B. zwanzig Originalsprachen ? Wenn ich daran arbeiten sollte, bräuchte ich jedenfalls Beratung durch weise Mitmenschen, vermutlich aus all diesen ganz unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen. Noch dazu, wo ich gar nicht weiß, ob eine „von mir erfundene“ Mikrointervall-Tonfolge vielleicht in irgend einer „Naturvolk“-Tradition längst existiert hat ?
Ein Tor zu ganz unendlich verschiedenen Möglichkeiten ist durch die von mir in der 3.Sinfonie weiterentwickelte Tonsatz-Methode geöffnet:
Ein musiktheoretisches Lehrbuch darüber zu schreiben, wäre relativ einfach, würde aber wieder ganz spezielle Folgen und Fragestellungen bewirken (universitäre Studien-Curricula, neue Typen von Lehrveranstaltungen, Notenschrift, Gehörtest-Methoden usw.).
Oder ein Wiedererwecken des Ensembles „Harmonia nova“: Dies könnte praktische Probenarbeit und neue Erfahrungswerte beim Bewältigen der Spezialnotation ermöglichen - andererseits aber auch wieder die damaligen zwischenmenschliche Diskussionen neu aufleben lassen: „Weltmusik“ zwischen „Avantgarde“ und „Klassik“, etc., Kulturpolitik zwischen „Freiheit der Kunst“ und „tradierten Schönheitsdefinitionen“, usw.
Dazu eine persönliche Anmerkung: Die Freiheit der Kunst halte ich für eine unabdingbare Voraussetzung für Liebe – und Musik darf durchaus liebevoll (z.B. auch harmonisch) wirken für hörende Menschen.
Etwas zu den einzelnen Sätzen:
1.Satz, dramatisch
Zwei-Halbe-Takt durchgehend, anfangs Tempo MM = 60. Schon der zweite und dritte Ton der Klarinetten-Hauptstimme wirken (traditionell gewertet) „falsch“ („zu hoch“), der Halbtonschritt in der Celesta „zu klein“. Damit wird ein sanfter Anstoß zur ganzen folgenden Entwicklung gegeben – vergleichbar einem Kleinkind, das „so herzig ungeschickt singt“. Andererseits aber handelt es sich um ein ganz seriöses Thema in eigentlich klassischer Form und Harmoniefolge, das später auch von den Blechbläsern durchaus feierlich (aber „ebenso daneben intoniert“) vorgetragen wird. Besonders folgenreich wirkt der Ton der Hauptstimme in Takt 14 – über dessen Entstehung kann anekdotisch berichtet werden: Es gibt einen kleinen Schaltfehler an der Enharmonischen Mikroton-Orgel (wahrscheinlich wurden hier Lötstellen zweier Tasten verwechselt). Dadurch erklang hier beim ersten Ausprobieren der Melodie nicht der Naturseptim-Ton in der Oberstimme (rd. 30 Cent tiefer als am Klavier), sondern ein ebenso weit „zu hoch abweichender“ Ton. Den Ausdruck der so entstandenen Tonfolge empfand ich emotionell als irgendwie „empört“, und als ebenfalls sehr folgenreich für die Komposition. Zunächst versuchte ich, die Tonhöhe zu „korrigieren“ (sie z.B. „richtig als Naturseptim-Oberton zu notieren und zu intonieren“) – dann aber akzeptierte ich innerlich die spezielle Wirkung („falsch statt richtig“). Schon früher hatte ich oft beim Ausprobieren von Einfällen meine Finger als „intelligenter“ erlebt gegenüber meinem ursprünglich-theoretischen kompositorischen Konzept. Diese Arbeitsweise hat sich später auch in vielen nachfolgenden Einfällen bewährt. Oft habe ich erst nachträglich (anhand der Notation) analysiert, was ich da quasi unbewusst komponiert hatte. – Mit dem Einsatz der Tuned Bells in Takt 14 beginnt die quasi „interkulturelle Wechselwirkung“: Statt (z.B.) „südostasiatische“ Akkorde zu bilden, werden hier „Blue Notes“ vom „dafür unpassenden Instrument“ gebracht. Konsequente Mikro-Chromatik bringen in Takt 25 die Celli erstmals als Kontrapunkt. Die große Freiheit der Tonhöhen-Abfolge ist aber ganz klar an den metrischen Schwerpunkten harmonisch gebunden. Ich selbst empfinde hier eine Steigerung des Spannungszustands, welche konsequent zum heftigen Ausbruch der Blechbläser hinführt. Fast „idyllisch“ wirken danach die (ametrischen) Imitationen von Tuned Bells und Celesta über mikrointervallisch changierenden Septakkorden in den sanften Streichern. In Takt 68 übernehmen die Streicher das erste Hauptthema, ab Takt 97 heizen die Blechbläser wieder die Stimmung auf. Damit beginnt die Entwicklung des Mittelteils, in dem Alban Bergs Zwölftonkadenz permanente Spannungssteigerung bewirkt. Erst nach diesem „Durchführungsteil“ erscheint erstmals das „dritte Thema“, welches den Schluss des ersten Satzes dann – gemeinsam mit dem „Bläser-Choral“ des ersten Themas – nach dem in Takt 234 beginnenden Fugato und der kürzeren Wiederkehr des „idyllischen“ Themas (ab Takt 302) dominieren wird. Der Stretto-Schluss des 1.Satzes zeigt eher schroff, wie viele und große Potentiale in der zuvor erreichten Schein-Harmonie quasi untergegangen sind, aber hier noch nicht direkt beantwortet werden können. Eine sehr „klassische“ Hörerin hat diesen Satz für sich zusammengefasst als „Power of Life“. Einem jüngeren Charts- und DJ-Hörer fehlte in dieser Musik der Beat, den Mittelteil des ersten Satzes empfand er als „Chaos, als würden viele Schulkinder irgendwelche Instrumente ausprobieren“, ein Volksmusik-Liebhaber empfand die Musik als misstönend (diese beiden brachen vor Satz-Ende den Hörversuch ab). Ein Pädagoge wieder empfand genau diesen enorm komplexen und diskursiven Mittelteil als den wichtigsten und für ihn subjektiv ansprechendsten Teil des ersten Satzes. Ein Redakteur goutierte die Fülle an fantasievollen Einfällen und die schräge Selbstironie dieser Musik (auch in den weiteren Sätzen).
2.Satz, melancholisch
Wie “von Wolken verhangen” beginnt die Musik, und diese Andeutung endet quasi resignativ fragend. Die „Antwort“ darauf ist nur scheinbar eine solche: Im 6/8-Takt entsteht eine quasi barocke Melodie – aber es ist ein Barock der Gegenwart, fremd in der Klangfarbe und den „abweichenden“ Tonhöhen. Auch diesmal wird diese scheinbare Harmonie unterbrochen durch die Blechbläser. Nach dem zweiten „barocken“ Ansatz (Takt 176) lösen Bansuri, Tanpura und Streicher eine Idee aus, welche die Entwicklung der Musik hier immer weiter zunehmend prägen wird, in ihrer immer unendlicher werdenden Sehnsucht und Sensitivität. Die Solo-Viola bringt ab Takt Takt 205 zwar noch ein wärmendes, hoch emotionelles Thema, dessen Folgen erst im vierten Satz endgültig wahrnehmbar werden können. Doch die dann weiter folgende Entwicklung hin bis zum Ende des Satzes konnte ich selbst noch nie hören, ohne dabei in Tränen auszubrechen – jedesmal wieder. Die Musik schwebt immer lockender hinauf und hinaus in geradezu jenseitige Gefilde - schließlich wird sie noch unfassbarer enden als der zweite Satz begonnen hat: Die Gefühle werden so grenzen- und namenlos, dass nichts mehr zu fassen ist. Von Melancholie ist hier keine Spur mehr, nur noch unbeschreibliches, ratloses Staunen. - Eine „klassische“ Hörerin hat diesen Satz für sich zusammengefasst als „Mystic of Life“. Eine Hausmusikfreundin hörte sowohl im ersten als auch besonders im zweiten Satz gequälte Schreie einer gepeinigten Seele – auch sie schluchzte am Ende dieses Satzes.
3.Satz, Scherzo, tänzerisch
Manchen Hörenden fällt kaum auf, dass die raschen Tonhöhen-Wiederholungen der ersten Motive und Themen in Wahrheit mikrointervallische Abwandlungen sind: Die auf einander folgenden Tonhöhen sind nicht gleich, sondern minimal unterschiedlich. Anscheinend ist das Publikum dieses Phänomen gewöhnt, auch von klassischer Musik, und hört hier besonders intensiv „zurecht“. Scherzo ist eine Charakterbeschreibung: Wenn jeder Satz dieser Sinfonie ein psychologisches Temperament der quasi klassischen Tradition erscheinen lässt, dann eignet sich in dieser Sinfonie die Folge „Scherzo – Trio – Scherzo“ für eine ganz spezielle mikrointervallische Entwicklung, die den meisten Hinhörenden kaum bewusst werden wird: Das Scherzo beginnt und endet in B-Dur (das am Ende des Trios quasi wie eine Dominant-Tonart wirkt). Daraus folgt dann logisch der Beginn des Trios in Es-Dur. Innerhalb des Trios werden aber nun die Themen und Motive immer wieder etwas höher transponiert – aber nicht in Halbton-Abständen, sondern in viel kleineren Ton-Abständen, und daher einige Male öfter – bis sie zuletzt F-Dur erreichen (welches nun die Dominante zu B-Dur darstellt). Dadurch kommt es ganz logisch auch zur Reprise des Scherzos. Hierin sind quasi „die Instrumente der Hauptmelodien vertauscht“: Überall dort, wo im ersten Scherzo-Abschnitt ein „europäisches“ Instrument das Hauptmotiv spielte, da bekommt in der Scherzo-Reprise ein „exotisches“ Instrument dasselbe Thema oder Motiv – und umgekehrt. Zur Rhythmik im Trio ist noch ein Hinweis hilfreich: Der 5/8-Takt ist klar hörbar im Scherzo, und auch das Trio wird im (schnelleren) 5/8 Takt gespielt. Im Trio ist aber die 5/8-Rhythmik „maskiert“: Hier bleibt die rasche 5/8-Begleitung (Kora) zwar auch gleichmäßig wirksam, doch die Streicher spielen in Synkopen dazu eine scheinbare (rhythmisch leicht verzerrte) Walzer-Begleitung - das ist eben Musik aus Österreich: Man könnte tanzen dazu, aber vielleicht nur etwas hinkend ? Auf weitere „Späße“ in der Instrumentation, oder in den „verstimmten Oktav-Folgen“ wird hier nur kurz aufmerksam gemacht. Der Satz ist wirklich ein lächelnder Scherz. - Eine „klassische“ Hörerin hat diesen Satz für sich zusammengefasst als „Joy of Life“. Die 5/8-Rhythmik dieses Satzes hinderte eine Hörerin am „Mitschwingen“ bzw. „Mitempfinden“. Ein Hörer empfand genau dieses Phänomen als selbstironische Distanz zu den erhofften Themen, als scherzhafte Doppelbödigkeit.
4.Satz, Rondo, rasch
Eine langsame Einleitung erinnert zunächst sanft an die früheren Blechbläser-Ausbrüche. Darauf folgt eine ruhig beginnende Engführung einer Choralmelodie in dafür untypischen Instrumenten, begleitet von einem rascher werdenden Streicher-Klangteppich (für welchen ganz besonders viele Einzeltöne in höchstem Tempo aufzunehmen und zu kombinieren waren). Diese Streicherklänge entstehen als mikrochromatische Durchgänge zwischen kurz erklingenden vielstufigen Akkordzerlegungen ab Takt 25. Ein von Duduk und Bansuris begleitetes Streichquintett mit etlichen ekmelischen Akkordabwandlungen leitet ab Takt 41 über zum Hauptthema und Refrain in Takt 77. Dieses ist eigentlich eine energischere, quasi klassischere Variante des Hauptthemas aus dem 1.Satz. Diesmal aber entwickelt sich zum Synkopenrhythmus (ab Takt 93) eine mikrointervallische, mikrochromatisch aufsteigende Überstimme. Diese ergibt sich logisch aus Partialtönen über den ganz traditionell-klassischen Akkordfolgen. In Takt 125 beginnt ein Couplet mit Tuned Bells und mikrointervallisch modulierenden Akkordfolgen. Auf das anschließend wiederholte Ritornell folgt (T. 205) eine Thematik, die von traditioneller japanischer Gagaku-Musik angeregt erscheint: Eine langsam aufsteigende Imitation von Piccolo und Bansuri wird scheinbar unregelmäßig unterbrochen durch absurd wirkende Markierungen der Großen Trommel, zu denen bald ein liegender, sich verkürzend wiederholter Akkord (Partialtöne 7 – 12) über dem Orgelpunkt B (YB) und immer schneller werdende „südamerikanisch-polyrhythmische“ Motivfolgen hinzutreten. Sobald das entsprechende Tempo und die höchsten Tonlagen erreich sind, erscheint unvermittelt nochmals das „klassisch“ wirkende Ritornell-Thema (mit seiner ebenfalls mikrochromatisch aufsteigenden Überstimme). Nach einer kurzen Reminiszenz der Gong-Thematik und des Orgelpunkts wird der Schluss in Yes-Dur erreicht. Zwar ist dieser Satz kein Scherzo mehr, aber dennoch regt er offenbar an vielen Stellen die Hörenden zum Lächeln und Lachen an, aufgrund einer gewissen „Absurdität“ in der Kombination der musikalischen Ideen. Eine klassische Hörerin hat diesen Satz für sich zusammengefasst mit der Bezeichnung „Coming Home“, sie empfand den Satz als stimmige Klärung der musikalischen Situation der Sinfonie. Eine andere Hörerin empfand den Einsatz der Großen Trommel im letzten Satz als echte Schläge, und den Satz insgesamt als tragisch. Ich selbst empfinde beim Hören die komplette Sinfonie wie einen spannenden, äußerst abwechslungsreichen Ausweg aus einer enorm verwickelten Anfangs-Situation – und nach dem Hören der letzten Takte das beruhigende Gefühl: „Doch, so kann des Leben weitergehen“.
Kritische und selbstkritische Hinweise:
Die vielleicht selbstkritischeste Bemerkung zur Sinfonie ist der Hinweis, dass ich rd. vier Jahre vor der Fertigstellung einen komplett anderen Schlusssatz skizziert hatte (Hauptstimme, Begleitklänge usw. sowie der Formablauf standen bereits fest, der 4.Satzes hätte eine Art von variierter Gegenbarform gehabt). Ich musste diese Satz-Skizze aus biografisch-beruflichen Gründen weglegen, und fand inzwischen neue mögliche Zusammenhänge (z.B. zwischen Hauptstimme und Begleitung) heraus. Als mir dann das Fertigstellen der Sinfonie möglich wurde, entschied ich für diese neuen Möglichkeiten: Das Rondothema des Schlusssatzes ist eine raschere Variante des Hauptthemas aus dem 1. Satz – kombiniert mit einer logischen mikrointervallischen Fortsetzung, durch welche das Satzende (das Ende der Sinfonie) überhaupt erst erreicht werden konnte. Dadurch ergab sich eine Art von Rondoform für den Schlusssatz fast „automatisch“, sodass dadurch dieser Schlusssatz auch entspannter wirken konnte. Ein angenehmer Nebeneffekt der (quasi) Rondoform war, dass ich daran rascher arbeiten konnte, ein für mich psychisch dringender Wunsch, weil ich nach Fertigstellung längst schon ganz andere Kompositionen schreiben wollte, weil die finanziellen Geldgeber ein rechtzeitiges Abgeben der Partitur erwarteten - und mich dadurch nicht nur physisch, sondern auch vor allem auch mental überhaupt erst befähigten, nach rd. sieben Jahren doch noch weiterzuarbeiten.
Ein sehr wichtiger Hinweis (der mit dem vorigen untrennbar verbunden ist) ist nämlich auch der folgende: Ich habe z.B. beim digitalen Aufnehmen der Tonhöhen weiterhin meist „nur“ 48 Tonhöhen pro Oktave weiter verwendet, obwohl ich mit der U-Plex-Minimuse längst exakter hätte intonieren können. Und dieser Verzicht auf längst vorhandene neue Möglichkeiten blockierte meine Arbeitseinstellung zuletzt halt doch, zumindest phasenweise.
Im Sinne der Einheitlichkeit des Kunstwerks erschien mir aber diese Vorgangsweise doch die angemessene. Nur hat halt auch z.B. einen echten Nachteil: Die enharmonische Gleichsetzung der Naturseptim C-B mit dem Intervall C-AIS, wobei dieses Ais als Naturterz über einem Fis entsteht, welches selber wieder eine Naturterz über dem D ist, und das D aus der zweiten reinen Quinte über dem C resultierte: Aus dieser Gleichsetzung zweier an sich leicht unterschiedlicher Tonhöhen folgt eine gewisse Unreinheit der harmonischen Terz (bei der kleinen Septime ist das Problem weniger spürbar). Diese hätte ich ab dem 3. Satz korrigieren können – es aber bewusst unterlassen, um die Sinfonie wie begonnen fertigzustellen.
Ein weiteres Problem ergibt sich beim Hören dann vor allem aus meiner jeweiligen Entscheidung, welche Größe des Terz-Intervalls ich einspielte. In langsamen Akkorden wird die harmonische Terz 4:5 bzw. 5:6 meist als die passendere empfunden, insbesondere in Schluss-Dreiklängen (Dur bzw. Moll):
Aber wenn die Melodiestimme sich rascher bewegt (ein Grenzfall ist da z.B. zu finden im „Streichquartett“-Abschnitt im 4. Satz), dann erscheint die harmonische Großterz (die im Zusammenklang passt) melodisch als ein „zu tiefer Leitton“ zum nächsten chromatischen Ton (z.B. h zu c, oder e zu f).
Ein Orchester würde hier „instinktiv“ die Tonhöhe nachkorrigieren (und den Leitton h höher spielen). Nicht aber die Mikrotonorgel, insbesondere, wenn ich ausdrücklich die kleinere Großterz mit dem Frequenzverhältnis 4:5 (64:80) notiert habe, statt z.B. die pythagoreische Großterz 64:81 vorzuschreiben (oder eine noch größere mikrointervallische).
Das bedeutet: Ich könnte schon seit einigen Jahren (mit der Minimuse und mit gewissen Änderungen der Notation) viele Stellen der Komposition leicht verändern. Sie würde dadurch vielleicht für die Hörenden eingängiger und vertrauter wirken.
Dennoch habe ich mich dagegen entschieden – und damit vielleicht für eine künftige, noch viel kompliziertere Arbeit (mit z.B. weiter ausdifferenzierter Notationsweise). Denn ich habe bisher stets vermieden, meine Kompositionen „auszubessern“, sondern habe immer bevorzugt, die neue Erkenntnis dann in einer späteren Komposition anzuwenden.
Ob bzw. wie genau die notierten Instrumente überhaupt die jeweilige Mikrointervall-Tonhöhe exakt spielen können, ist eine Frage, die für die Aufnahme gar nicht gestellt wurde. Würde man aber die Instrumente dafür mechanisch um-konstruieren, dann würden sich ihre Klangfarben ändern. Also ist die Sinfonie mit dieser Methode nicht rein physisch aufführbar.
Das Phänomen der Ausschwingvorgänge war bei jedem Einzelton neu zu bewältigen. Dabei ist zunächst einmal folgenreich, dass bei den gesampelt verwendeten Instrumententönen zwei offenbar unterschiedliche Methoden der Wiedergabe im Programm Mixcraft/Kontakt wirksam werden: Wenn man die Taste drückt, erklingt bei machen Instrumenten-Klangfarben (vor allem Orgel, aber auch Streichorchester u.a.) der Ton so lange, wie die Taste gedrückt wird – bei anderen (z.B. Klarinette usw.) endet die Tonwiedergabe, obwohl die Taste weiter gedrückt ist von sich aus (und zwar nach der Dauer, die mit dem Atem des ausführenden Musikers durchgehalten werden konnte) – bei dritten Instrumenten (gestrichener Solo-Kontrabass u.a.) bleibt der klingende Ton auch ohne automatisches Ende hörbar, aber man hört zwischendurch das Wechseln der Bogenstrich-Richtung, also feine Klangfarben-Änderungen, die oft nichts mit dem Tempo der Musik zu tun haben.
Aus diesen digitalen Vorgaben folgten beim Aufnehmen der Sinfonie teils unterschiedliche Herausforderungen (und dass diese nicht immer ideal zu bewältigen waren, ist in der Aufnahme an vielen Stellen unüberhörbar) am Ende des jeweiligen Tons:
Am einfachsten zu erzielen waren meistens die Eindrücke von legato und portato, da hier das Ende eines Tons quasi maskiert und überlagert wird durch den Beginn des nächsten Tons. Oft genügte es, hier den nächsten Ton mit exakt gleicher Lautstärke beginnen zu lassen (wo der nächste Ton allerdings z.B. akzentuiert wirken sollte, musste die Lautstärkenkurve in den ersten Sekundenbruchteilen seines Erklingens digital nachträglich gestaltet werden – zuerst gleiche Lautstärke, dann sofort lauter, aber nicht zu plötzlich).
Wo aber nach einem Ton eine deutliche Pause folgen sollte, stellte sich die Frage, wie der Ton enden sollte (um „dennoch quasi natürlich“ zu klingen): An tausenden Stellen war dies nur möglich durch Reduzieren der Lautstärke in den letzten Sekundenbruchteilen – bei der Hälfte davon in einem mehrstufigen Verfahren, ein lineares oder apruptes Herunterfahren der Dynamik hätte sehr oft störend für den Gesamteindruck gewirkt.
Der natürliche Ausschwingvorgang des Instruments erklingt daher in dieser Aufnahme nur in ganz wenigen Fällen - vielleicht in weniger als einem Promille der Töne insgesamt. Sensibel Hinhörende bemerken das (und empfinden es nicht in jedem Moment als passend).
Würde jemand an diesbezüglichen Korrekturen arbeiten wollen, dann müssten die Ursprungs-Dateien jedes Tons nochmals aus dem Mixcraft-Archiv herausgesucht und adaptiert werden – es würde nur an ganz wenigen Stellen genügen, die bereits mehrstimmig zusammengesetzten Formabschnitte nachträglich zu korrigieren.
Ein weiteres Problem zeigt sich beim Tempo: Damit die einzeln aufgenommenen Töne des jeweiligen Instruments später mit der fertigen Melodie der anderen Instrumente gleichzeitig erklingen können (wie es ja notiert und beabsichtigt ist), habe ich das Metronom beim Aufnehmen mit verwendet. Daraus folgt, dass das Tempo der Aufnahmen fast überall ganz starr ist – es gibt in der Aufnahme nur in wenigen (noch mühseliger hergestellten) Momenten ein lebendiges Tempo-rubato. Ich würde dieses selber gern so hören wie mir die Musik eingefallen ist, die Emotionen würden bei Ändern des Herzschlag-Tempos wesentlich klarer und fasslicher werden. Ich bin nur derzeit schon ziemlich müde, jahrelang immer an der selben Komposition zu arbeiten. Und teils ist mir selber auch nicht mehr im Gedächtnis, in welcher exakten Tempo-Nuance mir ein Einfall ursprünglich in meine Fantasie geraten ist.
Das Tempo der jeweiligen Stelle angemessen zu klären, wird daher für immer ein Rätsel bleiben – was vielleicht gut ist, weil die Nachhall-Dauer in jeder räumlichen Aufführung sehr unterschiedliche Voraussetzungen schaffen wird. Ich kenne keinen idealen Aufführungsraum für diese Musik. Auch der Kopfhörer ist nicht ideal, weil dabei fast nur die Ohren von den Frequenzen betroffen sind, nicht aber der ganze Körper.
Ein weiteres Problem ist, dass mit der Exaktheit der Notation die Intonationsfreiheit menschlicher Ausführender grundsätzlich viel mehr eingeschränkt wird, zugunsten der größeren Entfaltungsfreiheit beim Komponieren – bis hin zum völligen Ausschalten eines lebenden Orchesters auf dieser CD.
Wenn die Situation des hörenden Menschen betrachtet wird, dann wirkt bei dieser Zahl unterschiedlicher Tonhöhen das Phänomen des „Zurechthörens“ in einer teils anderen Weise als bei traditionell chromatisch-diatonischer Musik:
Grundsätzlich ist zunächst beim ersten Hören nie klar, ob die gehörte Tonhöhe auch die ursprünglich gemeinte sei. Bei traditionell diatonischer Musik werden Töne, deren Frequenzen von den bekannten Tonleitern und Akkorden minimal abweichen, in der hörenden Klangfantasie um-interpretiert (zurechtgehört, „diese etwas andere Frequenz wäre eigentlich die gemeinte Tonhöhe gewesen“). Die Fähigkeit des Zurechtdeutens ist nämlich eine der grundlegenden Voraussetzungen, unvollständige oder undeutliche Informationen überhaupt wahrzunehmen und einzuordnen.
Nun hat das Gehör bei der digital eingespeicherten Sinfonie eigentlich diese Möglichkeit nicht in der gewohnten Weise: Jede Tonhöhe ist ja die beabsichtigte. Dennoch interpretieren die traditionell Zuhörenden an zahllosen Stellen die Tonhöhen um, wobei sie z.B. den Zusammenhang bestimmter Melodien oder bestimmter Zusammenklänge quasi „vereinfachen“.
Bei bestimmten anderen Tonfolgen bzw. Zusammenklängen haben sie aber diese Chance oder Aufgabe nicht – weil die erklingende Struktur dafür z.B. zu mehrdeutig, zu zusammenhanglos, zu vielstimmig, oder auch zu weit abweichend von klassischen Modellen wirkt.
Teils wurde in der Sinfonie mit solchen kaum zurechthörbaren Strukturmomenten bewusst gespielt – man könnte z.B. testen, ob alle Hörenden hier zurechthören, bzw. hin zu subjektiv welcher vermuteten (‚korrigierenden‘) Zielvorstellung.
Die teils so „schräg“ klingenden „Melodie- oder Akkordbestandteile“ wirken für traditionell hörende Menschen dann ähnlich wie die „süßen Intonationsversuche eine kleinen Kindes, das noch nicht imstande ist, die Tonhöhen exakt zu treffen“, oder sie wirken „wie fremde Musiktraditionen“ (und können deswegen allerlei Emotionen bis hin zur Ablehnung oder besonderen Neugier wecken). Teil wirken sie wie unterschwellig in einem Gespräch, wo in jedem Fall emotionelle Botschaften mit preisgegeben werden, zusätzlich zum sachlichen Inhalt der mitgeteilten Wortbedeutung, quasi Zwischentöne“ oder „Untertöne“, die beim Sprechen oder im Rap nicht als Teile einer traditionellen Tonhöhenordnung eingeordnet werden. Gerade die sogenannte „Abweichung“ kann damit zur zentralen Botschaft werden.
Wo die Grenzen sind, ab denen bestimmte Menschen eine neuartige mikrointervallische Struktur gar nicht mehr ‚zurecht‘-hören, oder ab welchem Ausmaß der Ähnlichkeiten andere Menschen „zurechtzuhören beginnen (was ab dann eigentlich als „zu-unrecht-hören“ bezeichnet werden müsste): Diese Unterscheidung- und Korrekturprozesse werden wohl von Mensch zu Mensch und von Musiktradition zu Musiktradition unterschiedlich wirksam werden.
Das Zurechthören ist aber nicht das einzige dabei relevante Phänomen, sondern es gibt auch ein Zurechtschwingen von Zusammenklängen, die (ähnlich dem Einschwingvorgang des beginnenden Einzeltons mit seinen harmonischen Partialtonen innerhalb von Sekundenbruchteilen) den Eindruck eines „Akkords“ während dessen Erklingen verändern können, obwohl in der Notation der Musik gar nichts geändert wurde. Dieses Phänomen des Zurechtschwingens erfolgt bei Akkordtönen zwischen (z.B.) Orgelpfeifen automatisch, bei Chören durch Übungsprozesse (auf einander Hören). Und die Frage stellt sich, ob und wie dieses Phänomen beim Erklingen digital gespeicherter Tonfrequenzen in Lautsprechersystemen, Kopfhörern, Radioapparaten und deren räumlicher Umgebung (Luftmoleküle) ebenfalls vergleichbar stattfindet.
Es könnte z.B. sein, dass bestimmte beabsichtigte Mikrointervallkombinationen durch Resonanzphänomene und durch die Brownsche Molekularbewegung so stark beeinflusst werden, dass das klingende Ergebnis nicht mit dem notierten übereinstimmen könnte. Möglicherweise war es deshalb bei der digitalen Aufnahme der Sinfonie „notwendig“, manche Töne in ihrer Lautstärke anzuheben (damit sie z.B. überhaupt wahrgenommen werden können).
U.-D.S.