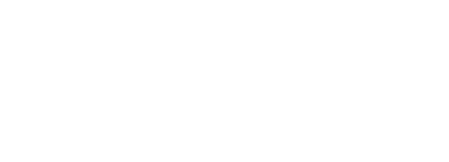Ulf-Diether Soyka Defizite klassischer Musik
Warum aber ist die Ausformung neuer Tonsprachen danach noch weiter gegangen ? Dass die nächsten Jahrhunderte keineswegs als "Entartung" der Klassik gewertet werden können, sollte heute eigentlich allgemein klar sein. Allerdings sind viele der neuen Musikformen innerlich keineswegs unabhängig von der Klassik gewesen.
Daneben ist fast völlig vergessen worden, dass gerade auch die musikalische Klassik Defizite hat - und unvermeidlich haben muss, da sie bewusst verzichtet auf bestimmte Merkmale.
Präzision versus Vollständigkeit
Die große Stärke der Klassik liegt - wenn man das so formulieren darf - in ihrer Präzision. Kaum je hat ein musikalischer Stil Polyphonie und Klang, Rhythmik und Menschlichkeit so harmonisch zur Übereinstimmung gebracht.
Durch Phänomene wie "Tonalität" (insbesondere in Form von Dreiklängen) zeigte sich in der Klassik diese Präzision. Die Entwicklung der Zentralperspektive ab der Renaissance, der Grundtonbezug und viele weitere Merkmale wiesen schon auf einen (eindeutig erkennbaren) Sinnzusammenhang hin. Jedes Motiv, jede Melodie standen bald zu diesem Zentrum in sinnvoller harmonikaler Beziehung. Es war nur eine Frage der Zeit bis es schließlich zu deren "klassischer" Ausformung kommen konnte.
Doch zeigt sich hier auch eines der größten Defizit der Klassik: Die Unvollständigkeit. Diese ist gewollt, ist ursprünglich als Verzicht bewusst intendiert worden, als Konzentration auf das Wesentliche. Aber alles Unvollständige hat Konsequenzen: Die weggelassenen Kriterien und Elemente werden irgendwann nachgeholt, und beginnen dann oft mit unvorhergesehener Übermacht zu wirken. Was eigentlich im Zusammenhang mit der Intention sinnvoll erreicht werden hätte können, scheint sich dann oft als Gegensatz zum Gelungenen zu präsentieren.
Worauf die Klassik vergessen oder verzichtet hat, das war aber keineswegs etwas Unwichtiges - und Meister wie vor allem Beethoven haben damit schwer gerungen. Wer eine Grundtonart, einen einzigen Grundton bevorzugt, der vernachlässigt alle anderen Töne, der reduziert und spezialisiert zugleich ihre Bedeutung. Dies war zwar in der damaligen Musikpraxis unvermeidbar, aber schon die Tonartenwechsel der immer gewagteren Durchführungen zeigten, dass wache Ohren das Defizit erkannt hatten und nach Auswegen suchten.
So gibt es auch schon bei Mozart - und später bei Schubert noch deutlicher - Ansätze, aus der siebentönigen Kadenz eine zwölftönige zu entwickeln. Einzelheiten können vielleicht in künftigen analytischen Lehrwerken nachgelesen werden. Und auch Wagners Chromatik war nicht ein "Verrat" an den Prinzipien klassischer Tonalität - sondern eine konsequente Suche nach dem Ausweg in einer naturgegebenen Herausforderung:
Klassische Klarheit der Ton-Relationen ließ sich nicht so ohne weiteres vereinbaren mit der Vollständigkeit und Gleichwertigkeit aller Töne.
Zur Sonanz- und Distanz-Ordnung in historischen Tonsystemen:
Die rationalen Frequenzverhältnisse tonaler Musik sind nur eine der vielen Möglichkeiten, die Fülle von Tönen in Sonanz-Systemen zu ordnen. Die Welt der Zusammenklänge ist davon zwar ebenso geprägt wie die der traditionellen Akkordzerlegungen - aber es gibt immer weitere Möglichkeiten der Anordnung, welche sich nicht direkt aus der "Naturtonreihe" ableiten ließen.
Ebenso prinzipiell gibt es z.B. die Möglichkeit der logarithmischen Frequenzordnung in der Form von Distanz-Systemen: Hier ist es das unterschiedliche Ausmaß der Entfernung zwischen Tönen, welches das maßgebliche Kriterium der Ordnung darstellt. Es gibt Töne, deren Frequenzen nahe beisammen sind, und es gibt fernere. Und diese Distanz lässt sich ebenfalls exakt messen (in cent). Ohne dieses Potential der Skalen, der Distanzen, gäbe es ebenfalls keine Musik.
Dass man streiten kann darüber, welchem der beiden "Prinzipien" der Vorrang gebühre (Sonanz oder Distanz), ist selbstverständlich. Diese Konflikte wurden ja auch entsprechend heftig geführt, vor allem im 20. Jahrhundert.
Verstärkend wirkten in diesen Auseinandersetzungen phasenweise die an sich pädagogisch hilfreich gemeinten Analogiebildungen, welche Musik oft als Codierungssystem für außermusikalische Botschaften zu verwenden suchten.
Wer Sonanzsysteme z.B. analog setzt mit Verwandtschaftsverhältnissen, der züchtet Ideenlehren, welche sich verselbständigen können - bis hin zu kulturpolitischen Forderungen. Wer durch bestimmte (z.B. "konsonante") Musik bestimmte pädagogische, soziale und wirtschaftliche Ergebnisse zu beeinflussen sucht, wird sich von bestimmten Distanzsystemen grundsätzlich gestört fühlen - und das gilt auch umgekehrt für die Bevorzugung von Distanzsystemen, deren Anhänger sich durch Sonanzsysteme gestört fühlen wollen, können bzw. dürfen.
Denn Distanzsysteme gehorchen grundsätzlich anderen Regeln als Sonanzsysteme. Und gewisse Regeln sind immanent, in Musik, Gehör, Akustik usw.
Nachdem beide Anordnungen (Distanz und Sonanz) unvermeidbar Teil der Musik sind, ist die Frage der Wertigkeit nur bis zu einem gewissen Grad beantwortbar (man denke zum Beispiel an Versuche, auf- und absteigenden Melodien je unterschiedliche Affekte zuzuordnen, oder Dur für "männlich" und "Moll für "weiblich" zu erklären etc.).
Im Grunde ist es ja schon eine Vereinfachung, wenn man Töne als "hoch" oder als "tief" bezeichnet, oder wenn man Oktavtöne als "identische" Töne (mit gleichem Namen) bezeichnet.
Zahl der verwendeten Töne in unterschiedlichen Musikstilen:
Die historischen Auseinandersetzungen um verschiedene Möglichkeiten der Temperierung von Tonsystemen war nur eine der Folgen des unvermeidbaren Phänomens, dass sowohl Distanz- als auch Sonanz-Ordnungen nötig wurden. Die Zahl der verwendeten Töne konnte nicht ins Unermessliche wachsen. So war die Frage zu stellen, welcher Ton (genauer: Welche Frequenz) verwendet wurde, und welcher wegzubleiben hatte.
Die Frage der Vollständigkeit stellte sich zunächst schon innerhalb der "konsonanten" Klänge (Oktaven, Quinten, Terzen): Je reiner deren Frequenz-Proportionen intoniert werden (z.B. im Verhältnis 1:2, 2:3, 4:5, 3:6 o.ä.), desto schwerer kann es fallen, die Zahl der erklingenden Töne festzustellen:
Einerseits ergeben sich nämlich Differenztöne (u.a. im menschlichen Ohr selbst), die als "dritter (auch als vierter usw.) Ton" wahrgenommen werden (beim Frequenzverhältnis 4:5 wird z.B. die Differenz-Frequenz 1 zusätzlich wahrgenommen, als "tiefer Grundton"). Nicht nur bei "mathematisch reinen" Klängen kann es daher besonders schwer sein, festzustellen, wie viele Töne eigentlich real (und wie viele "zusätzlich") erklingen.
Zweitens werden bei besonders reiner Intonation von "konsonanten Akkorden" (wie z.B. im Frequenzverhältnis 2:3:4:5:6:8) einzelne Töne leichter überhört als bei "verstimmten" Akkorden. Dies ist manchmal durchaus beabsichtigt, z.B. beim Mixturklang der Orgelregister - aber für Dirigenten usw. ergeben sich dadurch spezielle Probleme: Wenn z.B. nicht unterschieden werden kann, ob ein Chormitglied besonders rein oder nur besonders leise mitsingt, wenn also schon die Zahl der Mitwirkenden nicht mit dem Gehör sicher beurteilt werden kann, wie sollen dann die komplizierteren Phänomene gestaltet werden ?
Die Frage der Vollständigkeit der zur Musik werdenden Frequenzen reichte aber noch weit über diese Phänomene hinaus:
Eine Quinte (im Frequenzverhältnis 2:3) auf die andere zu schichten, das führte zu einem anderen Tonvorrat, als Terzen (4:5) aufeinander zu schichten, oder beide Sonanz-Prinzipien zu mischen. Die Ergebnisse der Primzahl 3 ließ sich nicht ohne Problem vereinbaren mit den Ergebnissen der Primzahl 2 (Oktaven) oder 5 (Terzen und Sexten). Jedes dieser Ordnungssysteme brachte (neben seinen Vorzügen) andere Nachteile (Kommata, gespaltene Orgel-Tasten, "heulende Wölfe" usw.), und jedes System wurde daher in seiner Gültigkeit eingeschränkt (z.B. temperiert).
Fragen wie die folgende wurden unvermeidbar: Sollte z.B. auf der 9. chromatischen Orgeltaste ein "gis" (als reine große Terz über der Durterz "e") intoniert werden - oder ein "as" (als reine Qinte unterhalb der reinen Mollterz "es") ? Oder sollte man auf die Reinheit der Intervallproportionen verzichten, indem man alle cent-Distanzen einander anglich ?
Je nachdem, ob man nun Sonanz- oder Distanz-Kriterien heranzog zur Entscheidung der Frage, welcher Ton denn eigentlich verwendet werden sollte, ergaben sich dann daraus unterschiedliche Temperierungsmodelle und damit Tonsprachen (chinesisch: "Ändere einen einzigen Ton, und du änderst die ganze Welt").
Es gab und gibt dabei keine "allein richtige" Lösung, sondern eine Fülle von Stilen, die alle untereinander durch diese Gesetzmäßigkeiten hintergründig bzw. innerlich verbunden sind.
Natürlich gibt es allgemein gültige Naturgesetze der Akustik, der Gehörs-Physiologie usw. - aber die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden, waren immer unterschiedliche - eine Begleiterscheinung der pluralistischen Vielfalt begeisternder Stile und Tonsprachen.
Hierarchien der Intervalle
Die Frage der "Hierarchie der Intervalle" z.B. lässt sich in Wahrheit nicht trennen von den Fragen der Temperierung und der Auswahlsysteme verwendeter (bzw. weggelassener) Frequenzen. Es macht ja einen Unterschied, ob in einer heptatonischen Skala der 2. oder der 6. Ton "dissonant" gestimmt wird (was z.B. zur "Wolfsquinte" in der Durtonleiter führen kann). Aus diesem Unterschied wird z.B. deutlich, warum in Bruckners letzter Symphonie die Symbolik der "Hölle" auftaucht, während in anderen Werken (bei anderer Temperierung) der d-Moll-Dreiklang als Konsonanz gewertet und erlebt wurde.
Leider wissen viel zu wenige Interpreten über solche Grundlagen ihres Musizierens Bescheid. Und sogar Musikkritik, Musik-Ästhetik und Kulturpolitik vergaßen oft darauf, wenn sie ihre eigenen Kriterien zur Auswahl der jeweils bevorzugten Musik durchsetzen wollten.
Selbst eine unbezweifelbare und allein (!) gültig wirksame Hierarchie von Intervallen müsste zumindest zwei Enden haben - ein oberes und ein unteres (wonach durchaus auch "die Letzten die Ersten sein" können): Und schon daraus folgte teils eine unterschiedliche Wertung ein und desselben Intervalls bzw. seines Konsonanzgrades. Ist Gott aber nun als der Kleinste oder als der Größte zu denken ?
Nicht immer und überall galten so genannte konsonante Intervalle als höherrangig gegenüber sogenannten Dissonanzen. Natürlich war es bei einer Quinte schwieriger, sie "dissonant" einzusetzen als bei einer Septime - und natürlich ist es schwieriger, eine Septime "konsonant" zu erleben als eine Terz. Insofern gibt es sicher so etwas wie natürliche Voraussetzungen für die Anordnungrn von Zusammenklängen und Tonfolgen. Aber auch diese Ordnungssysteme sind nicht möglich als eindimensionale Ableitungen aus (z.B. rationalen) Verhältnissen. So eine einzige "Hierarchie der Töne" ließ sich aus gutem Grund niemals verbindlich und fehlerfrei beweisen.
Denn auch hier wird das Zusammenwirken zumindest ZWEIER Aspekte zugleich beobachtet: Sonanz (Frequenzen-Relation) UND Distanz (Intervallgröße).
Nur dort wo das Ordnungssystem der Distanzen (z.B. der Halbtonschritte) zusammentraf (!) mit dem Ordnungssystem der Sonanzen (z.B. abgeleitet aus der Partialtonreihe), nur dort entstand so etwas wie eine Hierarchie von Tönen, die DANN mehr oder weniger gut in BEIDE Ordnungssysteme paßten.
Dafür nur zwei Belege:
Ein Intervall, dessen beide Töne noch so gut verschmelzen wie beim 7.Partialton, das aber fast ganz außerhalb der verwendeten temperierten Halbtonschritte (bzw. ihrer Zurechthörbereiche) liegt, wurde in der Musik der europäischen Klassik daher dennoch als "dissonant" gewertet (und aus dem verwendeten Tonvorrat der Konsonanzen ausgeschlossen).
Und ein Intervall wie der verkleinerte, "geschärfte" Halbtonschritt, der noch so passende Übergänge zum Nachbarton (Distanz) erlaubte, wurde im klassischen Europa dennoch nicht zur Bildung neuer Skalen mit kleineren Tonschritten herangezogen, nachdem sich dadurch zu viele "unreine" Intervalle (Sonanz) ergeben hätten.
Es gab sozusagen in Europa stets (mindestens) zwei Hierarchien der Töne, beide mit gegenseitigem Vetorecht.
Selbst innerhalb "der" Klassik gab und gibt es also stets mehrere Hierarchien der Töne nebeneinander. Innerhalb des jeweiligen Ordnungssystems gilt die jeweilige Hierarchie als verbindlich. Aber es ist wesentlich, festzustellen, dass daneben andere Ordnungssysteme (und Hierarchien) ebenfalls exisitieren - und einander ergänzen können.
Neben der Auseinandersetzung zischen Distanz- und Sonanz-Ordnungen und neben der Frage, welche Töne denn überhaupt verwendet werden konnten, stellte sich aber auch eine weitere, bald noch umstrittenere Frage - nämlich die nach der Konsonanzgrad.
Konsonanzgrad, Intonation und tonaler Zusammenhang
Diese Frage nach Konsonanz oder Dissonanz von Intervallen wäre natürlich stets auch auf dem beschriebenen Hintergrund der Intonation (der mathematischen Relation von Frequenzen) zu werten gewesen: So gab es keine Konsonanz "an sich" (obwohl "die Klassik" fallweise als Beleg für solche Vorstellungen zitiert wurde) - und es gab keine Dissonanz "an sich". Sondern es handelt esich um ein Bezugssystem mit inneren Variablen und daraus resultierenden Möglichkeiten.
Selbst die reinste Quarte kann im "klassischen" Zusammenhang SOWOHL eine Konsonanz als AUCH eine Dissonanz sein: Konsonanz war die Quarte z.B. im vierstimmig gesetzten Durdreiklang in Oktavlage. Dissonanz war die Quarte im Quartvorhalt oder im (daher auflösungsbedürftigen) Quartsextakkord.
Auch andere Intervalle wurden schon damals sowohl als Konsonanz als auch als Dissonanz eingesetzt. Beispiele dafür zeigten sich im Übermäßigen Dreiklang - zwei großen Terzen bzw. das Rahmenintervall einer kleinen Sext galten sonst als Konsonanz, hier aber wurden teils einzelne der Intervalle, teils auch der ganze Akkord als Dissonanz gewertet, musiktheoretisch erklärt und subjektiv erlebt. Und ähnliches galt für den Verminderten Dreiklang.
Auch die Terz ´konnte also schon zur Zeit der Klassik beides sein - Konsonanz UND Dissonanz - und dieses Phänomen galt bei der Quart sogar, wenn es sich um mathematisch exakt ein- und dieselben Intervall-Frequenzen handelt.
Zu den "Eigenschaften" eines Intervalls gehörte außer dem Grad von Konsonanz bzw. Dissonanz aber auch das Ausmaß der Distanz zwischen den beiden Tönen. Diese beiden Intervall-"Eigenschaften" (neben denen es weitere gäbe, wie Verschmelzung, Rauhigkeit usw.) waren zwar nicht unabhängig voneinander erlebbar, aber eine konnte auch nicht direkt aus der anderen abgeleitet werden.
Auch aus dieser Beobachtung folgte eine Entwicklung, die unvermeidbar über die Klassik hinaus weiter führte - weil sie aus innersten musikalischen grund-gesetzmäßigkeiten heraus weiter führen musste. Denn letztlich können alle Intervalle sowohl konsonant als auch dissonant erlebt werden - je nach Zusammenhang.
Erst mit Erreichen dieser Erkenntnis konnte (im 20. Jahrhundert) das größte Defizit der Klassik als überwunden betrachtet werden.
Wohlgemerkt: Das DEFIZIT der Klassik - denn die Klassik SELBST als solche ist unübertrefflich. Dennoch ist Klassik nicht per se etwas Besseres als (z.B.)Zwölftonmusik.
Unterschiedliche Wertungen historischer Musikstile:
Solche Wertungen obliegen den jeweils hörenden Menschen - sie lassen sich nicht aus den akustischen Sachverhalten alleine ableiten.
Aus der größeren Vollständigkeit in neuerer Musik z.B. lässt sich ja auch nicht zwingend ableiten, dass sie "besser" sei als die Klassik. Neuere (z.B. "chromatischere") Musik hatte (neben ihren spezifischen Stärken) nämlich durchaus auch ANDERE Defizite als klassische Musik.
Zur scheinbaren Dominanz von Distanz-Ordnungssystemen in neuerer Musik:
Bestimmte Grundlagen klassischer Musik wie z.B. siebenstufige Tonleitern, waren nicht nur weniger vollständig als z.B. zwölftönige Skalen, sondern sie ordneten den Tonraum auch bezüglich der Intervall-Distanzen weniger klar als bezüglich der Intervall-Sonanzverhältnisse.
Daraus folgte zunächst, dass als Ordnungsprinzip für zwölftönige Musik ganz speziell Distanz-Systemen (wie z.B. Zwölftonreihen bei Schönberg) eingesetzt wurden (und nicht mehr die klassischen Sonanz-Verhältnisse). Damit wurde eines der Prinzipien "tonaler" Musik (nämlich der Grundtonbezug durch rationale Frequenzverhältnisse) in seiner bis dahin scheinbar allgemein beherrschenden Funktion erschüttert.
Leichter und schwerer auffindbare natürliche Klang-Anordnungen:
Ein Problem dabei war aber, dass die Anordnung von Frequenzen in rationalen Proportionen durch führende Musiktheoretiker als "Naturtonreihe" bezeichnet worden war (weil sie ja in der Natur als ein Prinzip von Zusammenklängen entdeckt werden konnte). Infolgedessen wurde Zwölftonmusik (die dieses Ordnungssystem prinzipiell zu sprengen schien) zunächst abgelehnt.
Damals war aber kaum zu wenig bekannt, dass in der Natur EBENFALLS ANDERE Frequenz-Anordnungen entdeckt werden können - wie z.B. Glockenspektren u.a. Diese Spektren können nicht aus den "Konsonanzen" der "Naturtonreihe" alleine abgeleitet werden, sondern sie bringen in sich logisch ANDERE physikalisch bzw. mathematisch beschreibbare NATÜRLICHE Ordnungssysteme zum Klingen. "Dennoch" wäre niemandem eingefallen, den Klang der Glocke als "dissonant" (oder als "widernatürlich") zu bezeichnen (z.B. mit der Begründung, dass es in der Glocke doch keine "Naturtonreihe" zu hören gäbe).
Lange vor der Entdeckung WEITERER natürlicher Klangspektren war aber schon die unselige These von der angeblichen "Widernatürlichkeit" der "atonalen Musik" entstanden, mit all ihren tragischen Konsequenzen.
1990 wurde - durch Kurt Anton Hueber - ein "System der Harmonien" veröffentlicht, welches weitere "Naturton"-Anordnungen berücksichtigt: Saiten und Luftsäulen mit ihrer "Naturtonreihe" sind darin einer der Spezialfälle. Sie bringen andere Partialtonsysteme zum Klingen als etwa Kreisringe, Zylinderschalen, Kugelschalen oder Glockenschalen. Satt diese EBENFALLS natürlichen Klang-Anordnungen als "unharmonisch" zu bezeichnen und ungeprüft zu verwerfen, konnte nun in Tonstudios die exakte Anordnung der Teilfrequenzen jedes dieser natürliche Ordnungssysteme exakt untersucht werden. So konnte der Nachweis erbracht werden, wie sinnvoll, einfach und letztlich wieder harmonisch auch diese Naturordnungen sind.
Daraus folgte einerseits die Erkenntnis, dass es viele unterschiedliche "natürliche ordnungen" von Klängen geben kann, die alle ihren Sinn und ihre Funktion im Musikleben haben und immer hatten.
Zugleich - und lange Zeit unbemerkt - wurde eines der zentralen Argumente für neue Musik relativiert: Viele der Klangstrukturen "Neuer" Musik sind in der Natur (und im menschlichen Gehör) ebenso prinzipiell vorgeformt wie die "Naturtonreihe".
Jeder dieser natürlichen Frequenzordnungen entsprechen stilistische Entwicklungen, die im Laufe der Musikgeschichte mehr oder weniger bedeutsame kompositorische Resultate zur Folge hatten.
Daraus folgt nun allerdings auch eine Relativierung der Vorstellung über den menschlichen Geist und seine Fähigkeit, sich über Naturphänomene angeblich völlig frei hinwegzusetzen: Große Teile neuerer Musikgeschichte zeigen durchaus eine Ausfaltung der früher vernachlässigten ANDEREN natürlichen Möglichkeiten, Klänge zu ordnen.
Die Gegner zwölftöniger Musik glaubten ihre Argumente noch durch den Verzicht der "Zwölftöner" auf "Naturtonreihen" bewiesen (und ihr eigenes kulturpolitisches Tun hielten sie dadurch für gerechtfertigt). Diese Gegner der Zwölftonmusik - welche "die" Zwölftonmusik" damals für "widernatürlich" hielten - haben sich gründlich geirrt.
Über Auseinandersetzungen, welche Anordnung von Tönen die geistvollere sei:
Umgekehrt glaubten manche Befürworter zwölftöniger Musik spätestens ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, ihre Entdeckungen wären Zeichen einer "höheren" (von Naturtonzwängen angeblich weniger abhängigen) Geistigkeit, und suchten ihre subjektiven musikalischen Entscheidungen dadurch zu rechtfertigen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen aus einer musiktheoretischen Unkenntnis BEIDER Kontrahenten entstanden war. Wieder einmal zeigten sich bedenkliche Konsequenzen von Theorie-Defiziten.
Der beschriebene Konflikt wäre bei wohlwollender Forschung leicht vermeidbar gewesen - nicht nur durch rechtzeitige Entdeckung der EBENSO "natürlichen" Glockenspektren usw. Sondern auch durch genaueres Hören auf die Musik der damaligen Zeit selbst.
Viele Komponisten konnten damals bereits Akkorde von Konsonanzen in Dissonanzen verwandeln und umgekehrt, indem sie Intervalle bzw. Akkorde jeweils ALS Konsonanz oder ALS Dissonanz einsetzten. Dieser längst erreichte Freiheitsgrad schien vielen Musikern dann durch die Regeln strenger Dodekaphonie zunächst eingeengt.
Verzicht und Defizit "atonaler" Musik:
Eines der größten Defizite bestimmter Zwölftonmusik war im 20. Jahrhundert nämlich ihre zunächst prinzipiell scheinende, fast automatische "Grundtonlosigkeit" (die ja auch als Befreiung von tonalen, teils zwanghaft gewordenen Gewohnheiten angestrebt worden war - und die durchaus erstrebenswert war).
Dieses Defizit "atonaler" Musik wurde von Alban Berg erstmals in aller Konsequenz verdeutlicht und, leider erst in seinem letzten Werk, überwunden. Seine Musik konnte zwölftönig sein UND grundtonbezogen zugleich - und schließlich auch kadenzierend. Aber auch bei Richard Strauss (in der Oper Salome), in bestimmten Formen des Jazz, und eventuell schon im 19. Jahrhundert (bei Smetana) wären Vorformen und Varianten zwölftöniger Kadenzen auffindbar gewesen.
Was die verschiedenen verfemten Musiker im 20. Jahrhundert wollten, das war etwas von jeher schon Angestrebtes und Wertvolles: Präzision mit Vollständigkeit zu verbinden, und die Ordnungen von Sonanz und Distanz (beide) sinnvoll zu bewältigen. Wieweit dies rein innerweltlich bewältigt werden kann, und wieweit Menschen dazu letztlich imstande sein können: Diese Fragen sind noch nicht beantwortet.
Ein Defizit Klassischer Serieller Musik
Die Zwölftonordnung wurde nach Anton v. Webern konsequent weiter entwickelt. Seriell geordnet konnten nun alle Parameter werden: Nach der Tonhöhe auch Tondauer, Laustärke, Spielweise des jeweiligen Tones usw. Ein Parameter blieb aber bei Stockhausen und Boulez zumindest unberücksichtigt: Die Schwebungen wurden bis in die 1980er-Jahre nur nicht seriell geordnet. Dies war keine unbewusste Unterlassung - vielmehr hätte die Einbeziehung automatisch zum Verlassen des damaligen geschlossenen Systems Serieller Musik geführt. Dessen Serielle Ordnungen beruhten ja auf einem Verzicht auf den Tonalitäts-Charakter von Intervallen.
Schwebungen können am leichtesten gehört - und somit seriell geordnet - werden, wenn zwei Frequenzen in fast reiner ganzzahliger Proportion schwingen. Die Differenz zum rationalen Frequenzverhältnis kann dann dem Gehör als Tempo der Schwebung erscheinen.
Schwebungen seriell zu ordnen (ein Intervall schwebt z.B. 9x, das nächste 12x, das nächste 4x, entsprechend der vorgegebenen Reihe), das hätte bedeutet, speziell auf den "Reinheitsgrad" des jeweils intonierten Intervalls und seiner Partialtöne zu hören. Damit wären die zentralen Fragen der Intonation feinster Tonhöhenunterschiede pädagogisch bewußt gemacht worden. Dies lag aber nicht im Interesse der Proponenten klassischer Serieller Musik wie z.B. Szockhausen und Boulez sowie der an deren Zielsetzungen interessierten Musikverlage. Es war daher nicht überraschend, dass in den ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt in den 1980er-Jahren die begonnene Diskussion über Schwebungen uznd ihre Konsequenzen für die Serielle Musik rasch wieder vergessen wurde.
Im 20. Jahrhundert vernachlässigte Parameter der Musik
Immanent in den Eigengesetzmäßigkeiten der Musik bleibt die Gegebenheit weiter wirksam, dass auch Schwebungen einen Parameter der Musik darstellen, welcher konstruktive Folgen von größter Bedeutung bekommt, sobald Töne zugleich erklingen.
Einen kleinen Beleg dafür stellte schon die bekannte Äußerung Alfred Uhls dar, welcher als Doyen der österreichischen Komponistenschaft erklärt hatte, er könne an einem perfekt gleichschwebend temperierten Klavier nicht komponieren (sondern er brauche dazu ein leicht "verstimmtes" Klavier mit charakteristischen Schwebungen).
So konsequent es war, den Parameter der Schwebungen auszuschließen aus dem Kanon der seriellen Ordnungen, so fatal wirkte sich auch diese Unvollständigkeit in der Folge für das gesamte Gebäude der "atonalen" Musik aus. Der nächsten Generation erschien das Gefüge der zwölf Töne nämlich als Ganzes zu eng zu. Die relative (größer gewordene, chromatische) Vollständigkeit der Distanz-Systeme innerhalb der seriellen Musik war EBENFALLS durch einen einseitigen Verzicht erkauft worden - und das dabei Ausgeschlossene begann nun plötzlich besondere Wirkungen zu entfalten. Schon Penderecki brachte so gesehen keinen Rückschritt, sondern eine Befreiung, hin zu neuen, teils mikrotonalen Tonsystemen.
Das Ende der Dominanz serieller Musik wurde vielleicht nicht so sehr durch die große Fehlerquote der ausführenden Instrumentalisten bewirkt (unter denen selbst Perfektionisten teils nur mehr 40% der Töne so bewältigen konnten, wie sie notiert waren). Natürlich war es damals konsequent, die angestrebten Klangergebnisse lieber gleich mittels Graphiken usw. anzudeuten (und die erzielten Ergebnisse waren bei "aleatorischer" Notation oft wirklich besser). Sondern zugleich erfolgte damals ein neuerliches Kippen des Tonsystems: Immer differenziertere Sonanzgrade zu bewältigen wurden bald wichtiger als das Einhalten serieller Regeln mit ihrer Gleichverteilung und Vollständigkeit.
Relativer bzw. absoluter Bezugspunkt des jeweiligen Ordnungssystems:
Vollständigkeit kann nämlich nicht nur innerhalb der wohltemperierten zwölftönigen Skala oder innerhalb von Distanz-Ordnungen angestrebt werden: Es gab und gibt immer mehr Versuche, eine Vollständigkeit der Sonanzen zu erreichen (z.B. in Gerard Griseys "Partiel", wo der Grundton (der Bezugspunkt der Zentralperspektive) immer tiefer nach unten verlagert wurde, bis er tief im Jenseits der Unhörbarkeit verschwand - sodass innerhalb des Hörbereichs demnach (theoretisch) ALLE Frequenzen konsonanter Teil einer einzigen rationalen Partialtonreihe sein konnten. Und auch Schönberg hatte schon mit den höheren Frequenzbereichen der Partialtonreihe einige Details seiner zwölftönigen Musik zu begründen versucht.
Die Funktionsweise des "absoluten Gehörs" - welches als eine Folge eines "unbestechlichen Gedächtnisses" innerhalb des Distanz-Systems alle Tonhöhen korrekt den Notennamen zuordnen kann - resultiert aus den Vorgaben der Distanz-Ordnung von Tonhöhen (ihrer Cent-Distanz zum Kammerton).
Prinzipiell unabhängig davon funktioniert das "relative Gehör", welches die Frequenzproportion (Sonanzgrad) zwischen zwei Tönen beobachtet und so die Intervalle exakt zu benennen hilft - unabhängig von deren absoluter Tonlage (eine Quint 2:3 ist eine Quint, egal in welcher absoluten Höhenlage sie erklingt).
Mindestens zwei - prinzipiell verschiedene - Möglichkeiten für Vollständigkeit:
Distanz- und Sonanz-Ordnungen, Absolutes und Relatives Gehör: BEIDE Schulen drängen also nach Präzision und beide drängen nach Vollständigkeit.
Beide gehen aber von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Um welche Vollständigkeit geht es also ? Um eine vollständige Obertonreihe (rationale Frequenzverhältnisse) ? Oder um eine feinstufig-vollständige chromatische Skala (logarithmische Frequenzanordnung) ? Wie ließen sich beide Ordnungssysteme in der Praxis zur Übereinstimmung bringen ?
"Zurechthören", Umdeuten und andere "Kompromisse":
Die Annahme von "Zurechthörbereichen" (Rudolf Haase) war sinnvoll und ist unvermeidbar, solange Intervalle unterschiedlicher Herkunft und Systematik nur als "gleiche" Intervalle notiert werden können. Die Terzen 64:81 und 4:5 (also 64:80) bieten ganz unterschiedliche Hörerlebnisse und unterschiedliche Folgen im Tonsatz - obwohl sie in der traditionellen Notenschrift "gleich" aussehen, und beide als "große Terz" benannt wurden.
Dieses sinnvolle und unvermeidbare "Zurechthören" ist aber ein menschlicher Deutungsvorgang - nicht ein präzises akustisches Phänomen.
Natürlich konnte man auch "arabische oder ostindische Tonskalen zurechthören", z.B. wenn man sie vordergründig und rasch gemeinsam mit europäischen Skalen verwenden wollte. Aber dabei wurde sowohl der Hintergrund der europäischen als auch die Entstehung der "exotischen" Skalen aus dem Bewusstsein der Musizierenden weitgehend ausgeblendet.
Es gibt aber zwischen unterschiedlichen regionalen Tonsystemen viel tiefer verbindende Übereinstimmungen, die erst bei genauem Verständnis der Distanz- und Sonanz-Ordnungen offen erlebbar werden. Hierfür braucht es mehr theoretisches Wissen und tonsetzerisches Können als das billige "Sampeln" und Zitieren uns vorgaukelt.
Von der geistigen Fruchtbarkeit der Schismata:
Ein- und dasselbe Phänomen im klingenden Zusammenhang kann völlig unterschiedlich entstanden und gemeint sein. Und völlig unterschiedliche Klangergebnisse können den an sich gleichen Entstehungsgrund haben. HIER erst zeigen sich die Möglichkeiten höherer Geistigkeit: Das korrekte Entdecken der inneren logischen Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Musikstilen ist das Kennzeichen wahrhaft gebildeter Musizierender. Erst sie sind imstande, anhand des Fremden das sogenannte Eigene wirklich kennen zu lernen und zu bewältigen.
Denn schon die europäische Musikgeschichte ist ja derartig reich an Schismata (und damit an raffiniertesten Feinheiten der philharmonischen Intonation je unterschiedlicher Stile). Es sich lohnt daher, den inneren, logischen Zusammenhang all dieser "Abweichungen" und "Annäherungen" gegenüber den sogenannten "idealen" Skalen- und Sonanzssystemen genau zu untersuchen.
Jeder "geschärfte Halbton", jeder "charakteristische" Klang usw. hat ja seine spezielle Funktion - auch in der europäischen Klassik (das merken unsere verwöhnten Ohren, wenn wir z.B. vergleichen mit Filmmusik, die auf billigen Keyboards produziert wurde). Auch in Europa gab und gibt es wesentlich mehr als "die eine" Norm-Skala, und das ist gut so. Unsere heutigen Messgeräte bestätigen was den führenden Musiktheoretikern immer bekannt war: Nicht das puristische Dominieren EINER Gesetzmäßigkeit ließ musikalische Kunstwerke entstehen, sondern das Ringen inmitten der Konflikte zwischen den vielen sinnvollen Normen war es, in dem die Klassik und andere große Epochen entstanden sind.
Nicht um den Beweis für eigene endgültige irdische Ergebnisse konnte es gehen, sondern stets war das Geschaffene zugleich etwas noch Unvollendetes.
Wenn wir "zurechthören", und sagen "da war eine Terz gemeint" - was tun wir da eigentlich ? Und was tun wir, wenn wir versuchen "rein" zu intonieren ? Welche der beiden schismatischen Terzen ist denn jeweils die im Zusammenhang gemeinte ? Keine von beiden, sondern eine gewisse Distanz ?
Was ist Norm ? Was ist Abweichung ?
Diese Fragen sind keineswegs unbeantwortbar. Wir machen uns nur meistens die Antworten zu leicht, indem wir schon die Notation vereinfachen. Diese schlampige Tradition hatte Vorteile (z.B. konnte so jedes Schulkind Noten lesen lernen). Aber sie hatte immer auch Nachteile. Ihr größter Nachteil war und ist zugleich ihr größter Vorteil: Die bewusste Unvollständigkeit der Notenschrift. Im Vergleich zum Gehör der musizierenden Menschen war die Notenschrift weder vollständig noch präzise. Und sie wird es auch niemals sein können, wenn sie nicht überkompliziert wirken will.
Die europäische Notenschrift konnte weder jedes Intervall rein darstellen, noch konnte sie alle Intervalle gleichermaßen lesbar machen.
Unschärfe der Aufzeichnung und Beobachtung:
Wie jedes andere Hilfsmittel, so ist auch diese Notenschrift (und in ähnlicher Weise jeder Tonträger) ein Hindernis, eine Zensurstelle für den Geist.
Dadurch sollten sich aber die komponierenden und Musik ausübenden Menschen nicht hindern lassen, die eigentlichen Zusammenhänge zu erforschen: Was war beabsichtigt in der musikalischen Klassik, in einer bestimmten Komposition ? Welche Interpretationen sind stimmig und können wie Ikonen verehrt werden ? Und welche wundervollen Möglichkeiten können heute erst gefunden werden ?
Die Beschäftigung mit den musikalischen Phänomenen Präzision und Vollständigkeit ähnelt jener mit Werner Heisenbergs "Unschärferelation", wodurch der Erkenntnis des aktuellen Zustands eines Atoms grundsätzliche Grenzen nachgewiesen wurden:
Nur wenn man den Ort eines Teilchens energetisch (z.B. durch den Lichteinfall) veränderte, konnte man sehen, wo es sich befand - also befand es sich nicht dort, wo man es sah: Zumindest war es dort sicher nicht im Moment der Wahrnehmung.
Wie haltbar sind die Ergebnisse ?
Ähnliches gilt für die Prinzipien "guter Musik": Sind sie einmal "erkannt", verflüchtigen sie sich sofort. Aber um dieses Geheimnis zu verstehen, braucht es zuvor etliche Zwischenstufen der Erkenntnis. Und die Klassik ist eine dieser bewundernswerten Zwischenstufen - ebenso wie die gelungene Zwölftonmusik des 20. Jahrhunderts.
Vielleicht wird klassische Musik heute deswegen immer rascher und gehetzter aufgeführt, weil sich auch der Geist der Klassik verflüchtigt, sobald sie als solche erkannt ist ?
So oft ausführende Orchester und Chöre in einen (z.B. globalen) Wettbewerb geschickt wurden - statt dass ihnen globale Kooperation ermöglicht worden wäre - mussten in diesem ständigen Wettkampf um Aufmerksamkeit und Sensation automatisch jene Interpretierenden siegen, welche klassische Musik am schnellsten und präzisesten (statt z.B. am einfühlsamsten) exekutieren konnten.
Durch die Temposteigerung und die Studio-Akustik wurde baer fast unbemerkt der Ausdrucksgehalt dieser Musik gewaltig verändert - denn nicht alle Ausführenden konnten dieses Tempo mitvollziehen, ohne sich emotionell zu erregen, zu panzern oder ihrerseits die Hörenden zu hetzen.
Aber selbst bei den gelungensten Aufführungen im hohen Tempo wurde der emotionelle Ausdruck der Musik ebenfalls verändert: Die einst noch sangliche Hymne der Freude und Verbrüderung z.B. wurde dadurch verwandelt in eine tänzerische Musik (und erhielt z.B. mehr und mehr den Charakter eines Cancans).
Nun wäre gegen diesen Tanz als solchen ja wenig einzuwenden. Aber der beschleunigende Eingriff der Dirigierenden in klassische Musik könnte du8rchaus als solcher, als nachträglicher Eingriff gekennzeichnet werden. Er ist nämlich wesentlich größer als der Eingriff einer Regieführung in Dramen von Shakespeare.
Unter dem Vorzeichen, "das kulturelle Erbe Europas zu bewahren" wurde bei der Interpretation klassischer Musik eine konsequent neuartige, fast durchgehend tänzerische Tradition erst im 20. Jahrhundert eingeführt. Was klassische Komponisten wie z.B. Beethoven zu dieser beschleunigten Nutzung ihrer Symphonien usw. gesagt hätten, das lässt sich ermessen.
Dass der Cancan vielfach einer bestimmbaren emotionellen Atmosphäre angehört, ist in Frankreich immer bekannt gewesen: "Le cancan est une danse, exécutée (le plus souvent) par des femmes dans les cabarets à la fin du XIX e siècle" (Zitat aus der Datenbank Wikipedia).
Über klassische Musik und Musikschaffende der Klassik kann man geteilter Meinung sein. Die Vielfältigkeit des Kultur- und Musiklebens in Europas hat sich jedenfalls durchgesetzt gegenüber den Versuchen einer Normierung von musikalischen Tempo- und Regiekonzepten als angeblich "klassisches Kulturerbe".
Der großteils kommerziell verursachte Wettbewerb im Musikleben des 20. und 21. Jahrhunderts aber hatte und hat emotionelle Nebenwirkungen, welche durchaus auch kritisch wahrgenommen werden. Die klassischen Komponisten der großen Tradition können darauf aber nicht mehr persönlich oder kreativ reagieren.
Daher bleibt nur die Möglichkeit, dass an ihrer Stelle heutige Musikschaffende darauf hinzuweisen, dass es ja nicht um ein (an sich lebloses) "kulturelles Erbe" gehen kann - sondern es geht um die Zukunft von immer neuen Menschen. Und diese Zukunft kann nur kreativ lebendig gestaltet werden. Es geht also um Inspiration, um Heiligen Geist, um Leben, um Fantasie (und nicht um ein emotionelles Verzerren von angeblichen Traditionen in praktisch verdoppeltem Tempo).
Defizite können sehr heilsam wirken - wenn sie als solche gekennzeichnet werden dürfen, solange gesitvoll auf sie reagiert werden kann und darf - die gilt auch für Defizite klassischer Musik. Es ist eine Frage der Zeit - derjenigen Zeit, welche lebenden Musikschaffenden gegönnt wird für ihre langwierige Arbeit.
Beethovens, Mozart, aber auch Vivaldis und Bachs Musik wurde in ihrer emotionellen Wirkung zutiefst verändert - durch größere Säle, durch Lautsprecher, durch andere Stimmtöne, durch andere Klangfarben usw.
Daher ist folgende Frage nicht nur erlaubt, sondern wichtig:
Verblüht alle Musik unvermeidlich - in Epochen (also nicht in Tagen oder Wochen wie die Blumen) ?
Wo diese Frage guten Gewissens mit Ja beantwortet werden kann, da besteht Hoffnung auf weiteres freiwilliges Wachsen reifer Humanität, christlicher Nächstenliebe und aller edlen Werte der Menschheit - in Europa und darüber hinaus.
Da besteht Grund zur Hoffnung, auch im Musikleben.